Wengland 868: Herzog Christian von Sandragon, der Herzog Wenglands, wird von Verschwörern ermordet. Seine Familie kann nur knapp entkommen und findet Zuflucht im Kloster Wachtelberg. Auch sein Sohn Albert kann den Thron nicht zurückgewinnen, die Sandragons müssen nach Scharfenburg ins Exil.
Als der jüngere Sohn Philipp es versucht, verschlägt es ihn verwundet auf die Alvedrainsel, auf der eine Räuberbande lebt. Der Herzogssohn sieht in ihnen die einzige Chance, sein Erbe zu erlangen …
♦♦♦
Ohne weiteren Abschied verließ Philipp mitten in der Nacht Burg Stolzenfels. Seiner Mutter hinterließ er nur einen kurzen Brief. Die aufgehende Sonne fand den Herzogssohn bereits hinter dem Abzweig zum Rabenpass. Die Landstraße zwischen Stolzenfels und Steinburg verlief ziemlich gerade – soweit es das Glissatal zuließ – unterhalb des Halbmondswaldes. Das schroffe Bergmassiv trennte den Westen des Herzogtums von den östlichen Provinzen. Zwischen dem Halbmondswald nördlich des Alvedra und dem Oberwendländer Grenzwald südlich des Flusses bildete die Wachtelberger Pforte den leichtesten Weg zwischen Osten und Westen der Verborgenen Lande. Der Fluss, der sich in jahrtausendewährender Arbeit seinen Weg durch die kaum fünf Meilen breite Passage gebahnt hatte, war der Große Alvedra, der sich bei Wachtelberg, der Dreiflüssestadt Wenglands, mit dem Steinburger Alvedra und dem Glissa zum eigentlichen Hauptfluss vereinigte und das bedeutendste Flusssystem der westlichen Verborgenen Lande bildete.
Nur wenige Meilen hinter dem südlichen Ausläufer des Halbmondswaldes trennte der Alvedra mit seinen kristallklaren Wassern das Herzogtum Wengland vom Herzogtum Scharfenburg. Philipp trieb sein Pferd durch eine breite Furt, die schon seit der Zeit der Besiedlung dieser Gegend den Hauptübergang über den Grenzfluss bildete.
Philipp überlegte, wie er es am besten anstellte, seine Ansprüche ohne zu viel lebensgefährlichen Kampf durchzusetzen. Seit der Ermordung seines Vaters waren nun zwanzig Jahre vergangen. Vermutlich würde ihn in Steinburg niemand erkennen. Fraglich war aber auch, ob er Steinburg nach zwanzig Jahren Abwesenheit wiedererkennen würde. Viel konnte geschehen sein. Philipp beschloss, dem Usurpator einfach seine Dienste als Ritter anzubieten und loszuschlagen, sofern er genügend Getreue um sich geschart hatte, die mit den Soldaten des Thronräubers fertigwerden konnten. Er ermahnte sich häufiger, keine zu große Eile an den Tag zu legen. Eile war immer etwas Verdächtiges.
Am Abend des dritten Tages erreichte der junge Mann ein einsames Gehöft auf einer Waldlichtung in der Gegend des Klosters Wachtelberg. Der Hausherr, ein alter Bauer, sah den mit Schuppenpanzer, Helm und Schild unübersehbar als Ritter gekennzeichneten Reiter misstrauisch an, der das Hoftor passierte.
„Ich grüße dich, Bauer!“, sagte Philipp und hob grüßend die Hand. Der Bauer erwiderte den Gruß mit wachsamem Schweigen.
„Ich bitte dich um ein Nachtlager für mein Pferd und mich“, bat der Prinz. Der Bauer sah den Ritter etwas freundlicher an.
„Die Reihenfolge gefällt mir, Herr Ritter!“, sagte der alte Mann.
„Wer bist du?“
„Ein heimatloser Ritter. Philipp ist mein Name“, erklärte Philipp. Der Bauer sah ihn zweifelnd an. Er hatte noch den Herzog Christian gekannt – und dieser junge Mann hatte eine geradezu verblüffende Ähnlichkeit mit dem ermordeten Herzog!
„Ich kenne das Zeichen deiner Herkunft nicht“, bemerkte der Bauer.
„Mein Schildzeichen ist noch neu“, erklärte Philipp das Falkenwappen. „Ich hatte noch nicht die Ehre, in Wengland an einem Turnier teilzunehmen.“
„Hast du einen Herrn?“
„Nein, derzeit nicht. Aber wenn ich nicht zum Raubritter werden will, muss ich mir wohl einen Herrn suchen.“
„Herzog Reginald braucht jederzeit zuverlässige Krieger. Aber er ist gefährlich“, schlug der Bauer vor – und warnte gleichzeitig.
„Aha?“, stellte Philipp eher fragend fest.
„Ja. Herzog Reginald hat große Angst, jemand könnte ihm den Thron streitig machen“, sagte der Bauer und machte eine einladende Handbewegung. „Komm, Ritter Philipp. Sei mein Gast“, setzte er hinzu.
„Danke. Ich versorge nur rasch mein Pferd.“
Wenig später saß Philipp am Tisch des alten Bauern. Vor sich hatte er eine Schüssel Hirsebrei und einen Krug frisches Wasser.
„Sag, warum ist dein Herzog so in Angst um seinen Thron?“, fragte Philipp hinterlistig. Der Bauer seufzte tief.
„Es gibt Gerüchte, dass Herzog Reginald nicht ganz ehrlich auf seinen Thron gekommen ist“, sagte er.
„Wenn du mir das sagst, kann das für dich gefährlich werden, Bauer“, gab Philipp warnend zurück.
„Ich habe außer dem Leben nichts zu verlieren“, sagte der Bauer ernst. „Mein Leben habe ich gelebt. Ich bin alt, mein Sohn – so alt, dass der Tod kein Schrecken für mich ist. Nein, Ritter Philipp, die Häscher des Herzogs schrecken mich nicht.“
Philipp lächelte freundlich.
„Kommt sicher auf die Art an, in der du zu deinen Ahnen versammelt wirst. Es gibt Herrscher, die bevorzugen eine recht langwierige Methode“, warnte er.
„Ich weiß. Reginald gehört durchaus zu der Sorte, wie ich gehört habe“, erwiderte der Bauer.
„Ginge ich zum Herzog und verdingte ich mich ihm, könnte ich eines Tages als dein Feind vor deiner Tür stehen“, sagte Philipp. Der Bauer lächelte verschmitzt.
„Du nicht!“, sagte er bestimmt. Philipp schluckte den Bissen in seltsamer Langsamkeit hinunter.
„Wie meinst du das?“, fragte er.
„Ich habe den Herzog Christian gekannt. Lange Zeit habe ich meinem Herzog treu als Schildknappe gedient – bis zu jenem unglückseligen Tag, an dem er ermordet wurde und ich gerade noch fliehen konnte. Ich kannte die herzoglichen Prinzen. Prinz Albert hat Reginald schon auf dem Gewissen. Und den Prinzen Philipp, den muss er fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Und du, Ritter Philipp, du bist dieser Prinz!“, erklärte der Bauer. Philipp spürte ein Würgen im Hals.
„Meinen Plan kann ich aufgeben“, sagte er ernüchtert. „Wenn du mich erkannt hast, erkennt mich auch Herzog Reginald.“
„Wer weiß?“, gab der Bauer zurück. „Reginald ist nicht oft am Hof deines Vaters gewesen.“
„Mag sein, aber wenn ich meinem Vater so ähnlich sehe, dass du mich erkannt hast, erkennt mich jeder, der meinen Vater je von Angesicht gesehen hat.“
„Glaub’ mir, Prinz Philipp: In Steinburg gibt es nur noch wenige Menschen am Hof, die Herzog Christian noch gesehen haben. Und diese wenigen waren auf der Seite deines Vaters. Sie waren damals nur zu wenige, um den Soldaten Persegins zu widerstehen.“
„Dann muss ich mich wohl zunächst mit Graf Persegin befassen, oder was meinst du, Bauer?“
Der Bauer lächelte.
„Den brauchst du nicht lange zu suchen. Er sitzt als Reginald auf Wenglands Thron.“
„Woher weißt du das?“, fragte Philipp interessiert nach.
„Du hast bemerkt, dass ich ein gutes Menschengedächtnis habe. Persegin ermordete deinen Vater. Ich habe ihn an dem Tag einige Male gesehen. Dann tauchte er unter. Etwa ein halbes Jahr war Wengland ohne Herzog. Dann trat ein Baron Reginald von Aventwald zur Herzogswahl an. Als er inthronisiert wurde, war ich in Steinburg. Es war derselbe Mann, der deinen Vater getötet hat, ich schwöre es!“
Philipp dachte einen Moment nach.
„Ich gehe in die Höhle des Löwen. Ich muss es riskieren!“, entschied sich der Herzogssohn.
„Gib Acht, mein Prinz“, warnte der Bauer. „Dein Bruder hat sein Leben schon verloren. Such’ dir erst Verbündete. Es gibt durchaus noch Grafen in Wengland, die Reginald lieber heute als morgen stürzen würden.“
„Wohl kaum, um wieder einen Sandragon zum Herzog zu haben“, mutmaßte Philipp.
„Das kommt auf den Mann aus dem Haus Sandragon an. Du bist deinem Vater sehr ähnlich. Wenn du auch seinen Charakter geerbt hast, mein Prinz, bist du der geborene Herzog Wenglands“, entgegnete der Bauer freundlich lächelnd.
Philipp hatte den Rat des Bauern gehört – und er beherzigte ihn. Der Bauer wies ihm den Weg nach Eschenfels. Der Graf von Eschenfels war nach Aussage des Bauern eher ein Anhänger des Hauses Sandragon. Philipp schlug die empfohlene Richtung ein und erreichte nach einigen Tagen, in denen ihm nur ein paar unvorsichtige Hasen begegnet waren, Burg Eschenfels. Wachsame Torposten begleiteten den unbekannten Ritter zu Siegfried von Eschenfels. Der Graf von Eschenfels war bereits um die fünfzig Jahre alt und hatte vollständig weißes Haar. Der Ritter vor ihm stellte sich ihm als Philipp von Nirgendwo vor. Graf Siegfried brach in helles Gelächter aus.
„Du bist ein Spaßvogel, Ritter Philipp!“, rief er aus. „Sag’, wer hat deinen Ritterschlag vorgenommen?“
„Herzog Ralf von Scharfenburg war so gütig, mich in den Ritterstand zu erheben“, gab Philipp wahrheitsgemäß zurück.
„Du hast etwas zu verbergen. Sonst würdest du mir deinen richtigen Namen nennen.“
„Belass’ es dabei, Graf Siegfried. Es soll nicht dein Schaden sein“, beruhigte Philipp.
„Vielleicht nicht meiner“, erwiderte der Graf düster. „Vielleicht der meines Herzogs?“
Philipp spürte ein seltsames Ziehen in der Magengegend. Hatte der alte Bauer sich geirrt – oder ihn bewusst getäuscht?
„Ich kenne deinen Herzog nicht“, widersprach Philipp. „Warum sollte ich ihm schaden wollen?“
Siegfried erhob sich von seinem Hochsitz und ging langsam die drei Stufen hinunter, bis er mit Philipp auf einer Ebene war.
„Ich kannte einen jungen Grafen, voller Ideale und Ritterlichkeit“, sagte er langsam. „Er hatte viel Ähnlichkeit mit dir. Du hast den gleichen mittelwenglischen Akzent wie Graf Sandragon, der unser Herzog wurde und sich später Christian von Sandragon nannte. Du hast den gleichen dunklen Haarschopf und hältst dich auch ständig an deinem Dolch fest. Dein Gesicht gleicht dem des Herzogs Christian, als wärst du sein Ebenbild. Und der Schuppenpanzer, den du trägst, ist derselbe, den Herzog Christian nur an einem Tag nicht getragen hat. Es war der Tag seines Todes, als er von einem heimtückischen Mörder umgebracht wurde. Du bist sein Sohn!“
Philipp wollte aufbegehren, aber Siegfrieds herrische Handbewegung ließ ihn nicht zu Wort kommen.
„Wenn ich dich fortschicke, schicke ich dich in den Tod, Ritter Philipp. Außer mir steht nur noch der Graf von Eichgau loyal zur Familie Sandragon. Herzog Reginald würde dich sofort hängen lassen – wenn ihm nicht noch schlimmeres einfällt“, erklärte Graf Siegfried.
„Mein Leben ist sicher in Gefahr, wer immer ich sein mag, edler Graf. Gib mir Gewissheit, dass ich hier sicher sein kann.“
„Wenn du mir eingestehen willst, dass du Prinz Philipp bist, Herzog Christians jüngerer Sohn, will ich dir Schutz gewähren“, versprach Siegfried.
„Gut“, sagte Philipp. „Ja, du hast Philipp von Sandragon vor dir, Graf Siegfried“, bestätigte er dann.
„Dann sei mir willkommen. Ich betrachte dich als meinen Herzog, Prinz Philipp.“
Philipp hatte nun einen Ausgangspunkt, von dem er sein weiteres Vorgehen planen konnte. Graf Siegfried gewann den jungen Mann bald lieb, wollte ihn gar zu seinem Erben einsetzen, da er selbst keine Kinder hatte. Der Prinz fühlte sich an dem gastlichen Hof bald zu Hause, verstand sich mit Rittern und Gesinde fast so gut wie damals daheim in der Steinburg. Nach etwa zwei Monaten war der Prinz allerdings in seinen Plänen keinen Schritt weitergekommen. Er musste sich nun entscheiden, ob er für unbestimmte Zeit den wenglischen Thron anstreben wollte oder ob er doch nach Scharfenburg zurückgehen sollte, um die Grafschaft Dunkelfels anzunehmen. Unsicher, was er tun sollte, fragte er Graf Siegfried um Rat.
„Es ist wie mit dem Spatz in der Hand und der Taube auf dem Dach, Philipp“, sagte Siegfried. „Vom praktischen Standpunkt aus würde ich meinen, du solltest dem Herzog erklären, dass du sein Graf werden willst. Andererseits würdest du damit deine Ansprüche auf den Herzogsthron unwiderruflich aufgeben. Das wäre nicht gut für Wengland. Ich bin eigennützig und empfehle dir, nicht den bequemen Weg der fremden Grafschaft zu gehen, sondern den gefährlichen, unbequemen der Rückeroberung deines Erbes.“
„Glaubst du, dass die anderen Grafen mich anerkennen würden, gelänge es mir, den Thron zu erreichen?“, fragte Philipp nach.
„Du würdest sie überzeugen müssen. Manche sind sicher nur mit Gewalt zu überzeugen, dass ein Herzog aus dem Hause Sandragon – oder Wengland-Steinburg, wie es mit deutlicherem Bezug zu unserem Land und deiner Grafschaft genannt wird, der beste Herzog ist, den Wengland haben kann“, erklärte Siegfried. Philipp entschloss sich, zu bleiben. Nachricht konnte er Herzog Ralf immer noch geben.
Doch hierin hatte er sich getäuscht. Der Grund dafür lag näher, als der ahnungslose Philipp zu träumen gewagt hatte: Ungefähr zwei Wochen nach Philipps Ankunft war ein Stallbursche des Grafen mit Namen Holger auf einem Botengang Soldaten des Herzogs über den Weg gelaufen.
„Halt! Wohin des Weges, Bursche?“, hatte ihn einer der Reiter angerufen. Holger war stehengeblieben.
„Herr?“
„Wohin willst du, habe ich dich gefragt?“
„Zur Burg Eschenfels, Herr.“
„Was hast du da zu suchen?“
„Ich bin der Stallbursche des Grafen Siegfried“, hatte Holger stolz geantwortet. Die Soldaten hatten ihn ziehen lassen. Aber ein paar Tage später waren sie direkt bei seiner Lehmhütte erschienen.
„He, Holger, wer ist der Bengel?“, hatte der gefragt, der Holger schon auf dem Waldweg angesprochen hatte, und auf einen halbwüchsigen Knaben gewiesen, der die Ziegen des Knechtes fütterte.
„Mein jüngster Sohn, Herr.“
„Kann er schon etwas?“
„Oh ja. Er kann schon selbst Pferde versorgen, sie striegeln und satteln“, hatte Holger vaterstolz erklärt.
„Dann ist er dem Herzog durchaus von Nutzen. Dein Balg kommt mit uns mit“, hatte der Söldnerführer entschieden.
„Aber …“
„Holger, du möchtest doch bestimmt, dass dein Bengel es gut beim Herzog hat, oder?“
„Ja, natürlich.“
„Dann, Holger, wirst du deinem Herzog einen kleinen Gefallen tun. Du wirst ihm über alles, was sich am Hof deines Grafen tut, haarklein berichten, verstanden?“
„Aber Graf Siegfried …“
„Du berichtest einmal in der Woche nach der Messe in Eschenfels an einen Bettler, der eine Augenklappe über dem rechten Auge hat. Er wird dir ein Goldstück dafür geben. Solange du deine Berichte lieferst, wird deinem Sohn nichts passieren, klar?“
Holger hatte nur noch verschüchtert genickt.
„Noch was: Wage es nicht, deinen Herzog zu beschwindeln. Es gibt noch einen auf Eschenfels, der uns berichtet und der dich beobachtet. Wir würden es sofort merken, wenn du nicht die volle Wahrheit sagst. Sei sicher: Wir würden es dir nicht sagen, wenn wir dich beim Schummeln erwischen – aber dein Sohn wird es ausbaden!“, hatte der Söldnerführer gedroht und den Jungen mitgenommen. Holger hatte gehorcht und seitdem drückte sich oft ein Schatten hinter den Fenstern des Rittersaals herum. Holger, auf diese Weise zum Spion gepresst, gab brav jede Woche wahrheitsgemäßen Bericht über das, was sich am Eschenfelser Hof abspielte. Herzog Reginald hatte aus erster Hand Berichte über einen seiner letzten verbliebenen Feinde!
Eines Nachts, kurz nachdem Philipp sich zum Bleiben entschlossen hatte, rissen ihn grobe Fäuste aus dem Bett. Trotz aller Nahkampfgewandtheit dauerte der ungleiche Kampf gegen zehn Soldaten des Herzogs nur wenige Augenblicke, dann war Philipp überwältigt. Die Wachen stießen ihn gleich in den Rittersaal, wo Philipp den gleichfalls festgenommenen Grafen Siegfried traf – und Herzog Reginald. Der Herzog war selbst nach Eschenfels gekommen, um dem letzten Opponenten den Garaus zu machen. Nachdem Eugen von Eichgau gestorben war, hatte Reginald beschlossen, bei Graf Siegfried zuzuschlagen. Zudem hatte er endlich einen wirklichen Grund gefunden, gegen Siegfried vorzugehen, war ihm doch zugetragen worden, auf Eschenfels werde sein Sturz geplant.
„Nun, werte Herren?“, lächelte Reginald eisig. „Ihr seht, ich bin euren Plänen voraus!“
„Welchen Plänen, mein Herzog?“, fragte Siegfried verständnislos nach.
„Welche Pläne?“, äffte Reginald giftig nach. „Wenn du, Graf Siegfried, schon mein Herzog sagst, dann ist etwas faul!“, stieß Reginald verächtlich hervor. „Und wenn sich hier jemand aufhält, der schier das Ebenbild meines Amtsvorgängers ist, sind weitere Fragen wohl unnötig, was ihr zwei vorhabt!“, setzte er grollend hinzu und packte Philipp hart am Kinn. „Philipp, nicht wahr?“, fragte Reginald. „Meines lieben Vorgängers jüngster Sohn …“, setzte er hinzu, ohne eine Antwort abzuwarten. „Was solltet ihr wohl vorhaben, außer mich um meinen Thron zu bringen? Ich weiß, was ich weiß; das reicht. Eure Köpfe rollen im Morgengrauen. Der Henker wartet schon. Jetzt brauchen wir nur noch ein schönes Plätzchen, wo ihr zwei bis zur Hinrichtung sicher verwahrt seid. Also, Siegfried, wo ist dein Kerker?“
Philipp wollte aufbegehren, aber der Graf schüttelte den Kopf.
„Ich werde euch führen“, sagte er dann schicksalsergeben und führte die Wachen gehorsam in den Kerker.
„Du möchtest uns doch bestimmt in der dunkelsten Zelle wissen, Herzog, oder?“, fragte er unterwegs.
„Sicher“, grunzte Reginald unfreundlich. Siegfried brummte zustimmend und leitete die Posten in den untersten Kerkerraum. Reginald besah sich im Schein der Fackeln den feuchten, finsteren Raum. Er grinste breit.
„Das nenne ich einen angemessenen Kerker!“, freute er sich. „Ich werde mir deine Burg als besten Kerker meines Landes merken, Siegfried. Los, ‘rein mit euch!“
Die Wachen stießen die Gefangenen grob in die Zelle und verschlossen die Tür. Ein Posten blieb vor der massiven Eichentür, in der nur ein kleines, mit starken Eisenstäben vergittertes Fenster eingelassen war, das nur wenig Licht der auf dem Flur brennenden Fackeln in die Zelle ließ.
Philipp schüttelte nur noch den Kopf.
„Wie kann man nur so lammfromm sein?“, knurrte er so leise, dass der Posten es nicht hören konnte. Siegfried lachte leise. Er winkte Philipp zu sich heran. Philipp rutschte zu Siegfried hinüber.
„Die sind genauso dumm, wie ich gehofft habe!“, kicherte der Graf flüsternd. Philipp sah ihn verblüfft an.
„Was meinst du?“
„Achtung, erschreck’ dich nicht“, warnte Siegfried, stand auf, ging zur Wand und drückte auf einen Stein. Zu Philipps grenzenlosem Erstaunen ließ der Stein sich in die Wand schieben. Zwei Steinbreiten daneben drehte sich beinahe geräuschlos eine Geheimtür auf. Siegfried drehte sie ganz auf, winkte Philipp und sie schlichen sich in den hinter der Tür befindlichen Geheimgang. Das schwache Licht aus der Zelle reichte aus, um Siegfried ein kleines Depot mit Feuersteinen und Fackelstäben zu zeigen. Er schlug Feuer und entzündete eine Fackel, dann drehte er die Geheimtür wieder zu, schob er den Türöffner wieder zurück, die Bolzen der Geheimtür glitten wieder zu und verschlossen den geheimen Ausgang. Philipp sah dem Tun mit offenem Mund zu.
„Was ist mit dir?“, fragte Siegfried freundlich nach.
„Mir ist gerade ein ganzer Fackelzug von Lichtern aufgegangen!“, ächzte der junge Mann. „Der Gang führt nach draußen, oder?“
Siegfried nickte.
„Und auf der anderen Seite geht es in die Schatzkammer. Wenn du je in die Verlegenheit kommen solltest, dir eine geheime Schatzkammer anzulegen, kann ich dir nur empfehlen, den Eingang dazu in deinen tiefsten Kerker zu legen. Da vermutet ihn nicht der schlaueste Räuber. Komm jetzt.“
Um zwei Biegungen herum führte der Gang ins Freie. Vor dem Ausgang schützte ein liebevoll gepflegter, äußerlich aber normal chaotisch erscheinender Brombeerstrauch den Geheimgang vor unliebsamen Besuchern. Siegfried löschte die Fackel in einem Sandhaufen an der Seite des Ganges. Der strahlend helle Vollmond wies den Flüchtigen den Weg. Aber der Mond machte sie auch sichtbar. Das helle Leinenzeug, das sie trugen, leuchtete nur allzu gut im klaren Mondschein. Vorsichtig schlichen sie in Richtung einiger angebundener Pferde, als sich plötzlich einer der beiden Wächter umdrehte.
„Halt! Wohin des Wegs?“, rief er die beiden Gestalten an, die sich deutlich von dem dunklen Boden abhoben. In ihrem Schrecken, entdeckt zu sein, drehten Siegfried und Philipp um und hetzten auf den nahegelegenen Alvedra zu. Die Wächter überlegten nicht lange, sondern schossen Pfeil um Pfeil hinter den flüchtenden Männern her. Siegfried, der nicht ganz so schnell war wie Philipp, blieb leicht zurück. Drei oder vier Pfeile trafen ihn in den Rücken. Er stürzte und blieb tödlich verwundet liegen. Kurz bevor Philipp das Ufer erreichte, spürte er einen heftigen Schlag am linken Schulterblatt, dann einen stechenden, schnell anschwellenden Schmerz. Der Einschlag schubste ihn die noch fehlenden fünf Schritte zum Ufer. Kopfüber stürzte er in den Hochwasser führenden Fluss.
Die herbeieilenden herzoglichen Wächter sahen nur noch einen Baumstamm durch die rasenden Fluten schaukeln. Nein, es gab keinen Zweifel: Der Flüchtling musste mausetot sein. Wenn der Pfeil ihn nicht getötet hatte, dann der Fluss!
Hier endet die Leseprobe. Wenn dir diese Probe gefallen hat, findest du das ganze Buch mit 200 Seiten hier:
Philipp von Wengland Tredition Shop
12,00 € als Taschenbuch
19,00 € als gebundenes Buch
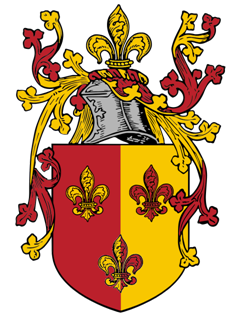

Schreibe einen Kommentar