Unmittelbar vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges tritt Wolf von Steinburg in die Dienste Graf Tillys, General der katholischen Liga. Wolf ist der Nachkomme der Könige Wenglands, doch die Familie ist verarmt, das Königreich lange verloren und in seine Grafschaften aufgelöst. Der brutale Krieg führt den jungen Mann kreuz und quer durch das Reich Kaiser Ferdinands II. Im Heer des Kaisers findet Wolf auch Männer, die so wie er aus Wengland stammen und sich ein Wiedererstehen des territorialen Wengland wünschen. Als Wolf in Stadtlohn der schönen Katharina von Braunsberg begegnet, verliert er sein Herz. Doch Katharinas Vater hat andere Pläne …
Prolog
Man schrieb das Jahr 1617. Wenn man die Landkarten dieses Jahres mit denen des 13. Jahrhunderts verglich, fiel – abgesehen davon, dass die modernen Karten erheblich präziser waren – eine gravierende Änderung auf: Die Königreiche Wengland und Wilzarien existierten nicht mehr. Sie waren einfach verschwunden, in das Heilige Römische Reich Deutscher Nation eingegliedert. Doch es gab noch die Grafschaften und Fürstentümer, aus denen diese Länder bestanden hatten. Wie war es dazu gekommen?
Wengland war ein glückliches Königreich, wenn es auch nicht immer mit vollkommenem Frieden gesegnet war. Nachdem König Ulrich I. nach fünf Jahren wilzarischer Besetzung mit Hilfe des Herzogs von Scharfenburg im Jahr 1264 eine genügend große Armee gegen König Ranador von Wilzarien und sein als unbesiegbar geltendes Heer hatte senden können und die Wilzaren tatsächlich vernichtend geschlagen waren, war Wengland um die Provinz Aventur und um ein Problem reicher. Das Problem bestand darin, dass weder Ranadors direkter Erbe Sevur noch dessen Nachfolger diese Provinz aufgeben wollten.
Trotz eines starken Friedenswillens des wenglischen Königs kam es alle paar Monate zu ernsthaften Grenzkonflikten mit dem Nachbarn Wilzarien. Diese Grenzkonflikte waren aber die einzigen kriegerischen Auseinandersetzungen, denen sich Wengland ausgesetzt sah. Mit den anderen Nachbarn bestanden unter dem friedfertigen König Ulrich und seinen Erben nicht nur freundschaftliche Beziehungen, sondern zeitweise sehr enge familiäre Verbindungen. So hatte eine Tochter Ulrichs den Fürsten von Breitenstein geheiratet, sein jüngerer Sohn Berthold hatte die Grafschaft Löwenstein geerbt und war in Scharfenburg ein geachteter Graf und Richter, der die Tochter des Markgrafen von Rebmark heiratete. Seit dieser Zeit entspannte sich das Verhältnis des wenglischen Königshauses zum Rebmärker Grafenhaus, das immer noch die Herzöge von Scharfenburg stellte. In den internationalen Beziehungen standen nur der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und der König von Wilzarien nicht freundschaftlich zu Wengland. Der König von Wilzarien eben wegen der ehemals wilzarischen Provinz Aventur, der Kaiser wegen der unabhängigen Existenz des Königreichs Wengland, das allen Werbeversuchen widerstand, sich ins Kaiserreich eingliedern zu lassen.
Im Innern hatte Wengland Frieden und einen Wohlstand, der mit dem seiner Nachbarstaaten nicht zu vergleichen war. Wenglands Bauern und Bürger arbeiteten zuerst für ihren eigenen Geldbeutel, dann erst für König und Vaterland. Bereits seit den Tagen Martins II. galt ein einheitlicher Steuersatz von zehn Prozent aller Einnahmen der Bürger Wenglands. Niemand, nicht einmal der König oder seine Adligen, waren von diesen Steuern befreit. Diese Steuerpraxis verhinderte die Leibeigenschaft, die in fast sämtlichen Nachbarstaaten Wenglands üblich war, weil damit Fronarbeiten der Bauern und Bürger völlig unterbunden wurden. Kein Bauer musste an die Scholle gebunden* werden, wie es im Heiligen Römischen Reich untertreibend genannt wurde. Ganz gleich, wie hoch der Ertrag war, der Bauer war sicher, dass neun Zehntel seiner Ernte und seiner Viehbestände ihm ganz allein gehörten. Der Geldfluss war regelmäßig und reichlich. Zwar konnten die Bürger wählen, ob sie den Zehnt (in diesem Fall entsprach die Bezeichnung auch den tatsächlichen Abgaben) in Form von Bargeld oder als Naturalleistung erbringen wollten, aber zumeist wurde die Abgabe bar geleistet. Der königliche Schatzmeister – meist war es der Graf von Eschenfels – verwaltete das Staatsvermögen Wenglands, das in den Fundamenträumen der Steinburg aufbewahrt wurde. Um diesen steinernen „Tresor“ wussten nur der Schatzmeister und der König selbst – ebenso, wie um den Weg, der in die Schatzkammer führte.
König Ulrich I. hatte kurz nach seiner Krönung seine Gesetzessammlung, den Codex Rex Wenglandia, in Kraft gesetzt. Neben dem Umstand, dass die dreimonatigen Exerzitien für den Thronfolger nach dem Tod des Königs wegfielen, hatte er die Gerichtsbarkeit in Wengland neu geregelt. Zwar gab es nach wie vor das Adelsgericht, das Streitigkeiten unter Adligen entschied, und die Grafschaftsgerichte, die die Prozesse der Bürger untereinander entschieden und auch zuständig waren, wenn sich Bürger und Adel stritten, aber die Besetzung der Gerichte änderte sich ein wenig. Das Adelsgericht bestand immer noch aus dem Grafenrat des Reiches, aber Ulrich verlangte von den Grafen, dass sie die Gesetze kannten und danach richteten – und nicht nach eigenem Gutdünken, wie das früher der Fall gewesen war. Die Gerichte der Grafschaften waren ursprünglich nur Sache des Provinzgrafen gewesen. Nun gab der Provinzgraf die Rechtsprechung an juristisch geschulte Leute ab, die nicht einmal zwangsläufig von Adel sein mussten. Voraussetzung für die Besetzung der Richterstelle war aber, dass der Kandidat lesen und schreiben konnte und die Gesetze Wenglands kannte. Sehr häufig wurden die Grafschaftsgerichte deshalb durch Geistliche besetzt. Um der Gefahr vorzubeugen, dass die geistlichen Richter statt des Gesetzbuches die Bibel zu Hilfe nahmen und mehr nach göttlichem Ratschluss als nach den Gesetzen des Landes richteten, ließ Ulrich den Richtereid auf den Codex Rex Wenglandia ablegen, den Treueid zum König auf die Bibel. Testamentarisch verpflichtete der König alle seine Nachfolger, diese unabhängige Gerichtsbarkeit zu achten.
König Ulrich I. hatte wie sein Großvater Wengland lange regiert. Die fünfundzwanzig Jahre seiner Herrschaft stellten eine Blütezeit des Handels und des Handwerks dar. Bauern, Händler und Handwerker machten Wengland reich. Diesen Reichtum behielt das Land aber nicht unbedingt für sich selbst, sondern gab ärmeren Nachbarn davon ab. Diese Praxis bewirkte, dass im Ausland kein rechter Neid gegen die Wengländer aufkam.
Aber es gab einen Feind, der auch Wengland unprovoziert angriff; einen Feind, der mit härterer Konsequenz zuschlug, als die Wilzaren es je getan hatten, der mehr Wengländer tötete, als sie in allen Kriegen gestorben waren, die Wengland in seiner nun fast fünfhundertjährigen Geschichte als Königreich hatte führen müssen; ein Feind, dem das wenglische Heer hilflos gegenüberstand, weil er mit Schwert und Lanze nicht zu bekämpfen war: Die Pest!
Die grauenhafte Pestepidemie, die in den Jahren 1348 bis 1352 fast ganz Europa überflutete und auf dem gesamten Kontinent etwa ein Drittel der Bevölkerung dahinraffte, wütete in Wengland besonders schlimm. Beinahe sieben Zehntel der wenglischen Bevölkerung wurden ein Opfer der entsetzlichen Krankheit, gegen die man kein Mittel hatte. Als man dahinter kam, dass die Ratten die Pest brachten, gab es nicht wenige, die herzhaft auf König Ulrich fluchten, der persönlich dafür gesorgt hatte, dass den Ratten nicht mit zu viel Härte nachgestellt wurde. Zu sehr hatte er sich daran erinnert, dass es eine Ratte gewesen war, die ihm einmal geholfen hatte, aus wilzarischer Gefangenschaft zu entkommen.
In der stets volksnahen königlichen Familie hatte die Pest schwere Opfer gefordert. Von der einst weit verzweigten Familie lebten 1353 noch der alte König Berthold, König Ulrichs jüngster Sohn, der bereits über achtzig Jahre zählte und Prinz Albert, ein Ururenkel von König Ulrich, der gerade mal sieben Jahre alt* war. Seit König Ulrichs Tod 1290 hatten nicht weniger als sechs Könige auf dem Thron Wenglands gesessen und ihn nach Ulrichs Vorbild verwaltet. Martin III., Ulrichs älterer Sohn, hatte dreißig Jahre regiert, sein Enkel Ulrich II. achtundzwanzig Jahre. Als Ulrich II. als erster wenglischer König 1348 an der Pest starb, beerbte ihn sein Sohn Adolf, starb aber noch im selben Jahr ebenfalls an der Pest. Rudolf II., Ulrichs II. jüngerer Bruder, erbte den Thron und starb nach wenigen Wochen an der Pest; ebenso waren seinem Sohn Simon nur wenige Wochen als König vergönnt, der kurz nach dem Jahreswechsel 1348/49 König wurde, denn nur wenige Monate nach der Thronbesteigung fiel er der Pest zum Opfer. Weil Simons II. Ehe mit Bettina von Bravadur kinderlos geblieben war, übernahm Mitte 1349 Berthold, Ulrich I. jüngerer Sohn, mit 82 Jahren den Thron, wofür er aus Scharfenburg zurückkehrte. Sein eigener Sohn Maximilian erlag nur Tage nach der Krönung seines Vaters der Pest, dessen Frau Carla starb Anfang 1350. So blieben nur König Berthold und sein dreijähriger Enkel Albert von der Familie Wengland-Steinburg übrig.
Wengland war ausgeblutet, denn praktisch alle Familien waren in dieser Weise von der Pest betroffen. Die Ernte war mangels Ernteleuten nicht eingefahren, es konnte nichts mehr ausgesät werden, es herrschte bittere Not in dem vorher so glücklichen Land. In seiner Not wandte König Berthold sich 1352 an den Kaiser Karl IV. und bat ihn flehentlich um Hilfe. Kaiser Karl sandte einen Unterhändler, der mit weit reichenden Vollmachten ausgestattet war. Der Unterhändler, Fürst Michael von Breitenstein, selbst mit dem wenglischen Königshaus verwandt, hatte viel Verständnis für den alten, bereits vom Tode gezeichneten König. Aber der Kaiser sah in Wenglands Hilferuf die Gelegenheit, sich dieses Reich endlich untertan zu machen. So hatte er Fürst Michael die unmissverständliche Weisung mit auf den Weg gegeben, dass Wengland als unabhängiger Territorialstaat verschwinden solle, in seine dreizehn Provinzen aufzulösen sei und dem Reich einverleibt werden solle. Um dies zu erreichen, bezog sich der Kaiser auf ein ebenso unbestätigtes wie unwahres Gerücht, dass Berthold gar nicht Ulrichs Sohn war, sondern aus einer unehelichen Liaison zwischen Königin Adelheid und Graf Siegmar von Aventur entsprungen war. Da die wenglische Unabhängigkeit an einen König aus dem Hause Wengland-Steinburg gebunden war, war dies die Möglichkeit eben diese Unabhängigkeit in Frage zu stellen.
Michael war darüber ausgesprochen unglücklich, weil er den Schutz durch den bedeutenden, mächtigen und militärisch starken, aber doch so friedfertigen Nachbarn Wengland wesentlich mehr schätzte, als die Lippenbekenntnisse des weit entfernten Kaisers, der von Prag oder Luxemburg aus noch nie diese schöne und friedliche Region besucht hatte. Aber des Kaisers Wille war unabänderlich. So, wie er die Mark Brandenburg dem Reich einverleiben wollte, wollte er auch Wengland haben.
König Berthold nahm die Bedingungen des Kaisers zur Kenntnis. Es war unerheblich, dass er das Gerücht der unehelichen Herkunft durchaus widerlegen konnte. Er konnte die Bedingungen nur akzeptieren oder einen Krieg mit dem Kaiser riskieren, der sich ohnehin auf den Weg nach Italien machen wollte, um seine Ansprüche dort durchzusetzen. Wengland hätte dann auf seinem Weg gelegen. Berthold war klar, dass er eine Auseinandersetzung mit dem Kaiser und dessen mächtigem Vasallenheer verlieren würde. Schweren Herzens nahm er die Bedingungen an.
Am 21. November 1353, nur wenige Tage nach der Vertragsunterzeichnung verstarb König Berthold an Altersschwäche und – wie die meisten seiner noch lebenden Untertanen behaupteten – nicht zuletzt an gebrochenem Herzen, dass er das hatte aufgeben müssen, was fünfhundert Jahre zuvor mühsam erworben worden war: Wenglands Königskrone. Auf Bitten von Fürst Michael und der wenglischen Grafen gestand Kaiser Karl zu, Berthold als König von Wengland im Dom zu Steinburg beizusetzen. Fürst Michael erwies dem toten König noch einen letzten Dienst, indem er Königskrone, Amtskette, Schwert und Zepter beiseite schaffte und sie im Felsentresor unter der Steinburg deponierte, statt sie Berthold mit ins ungeschützte Grab zu geben. Zu groß war die Gefahr, dass der Kaiser sie vernichtete oder zweckentfremdete. Es war Bertholds letzter Wille gewesen, dass sie eines Tages wieder einen freien König Wenglands zieren würden.
Doch bis dahin schien der Weg unendlich, nachdem der Kaiser die Grafen Wenglands zu reichsunmittelbaren Fürsten erklärte und sie damit vom Hause Wengland-Steinburg trennte. Fürst Michael wurde als Thronverwalter des kleinen Albert eingesetzt, der nun nur noch Anspruch auf den Titel des Grafen von Steinburg hatte. Wenn die Grafen von Steinburg auch immer noch das edle Blut der Könige Wenglands hatten: Sie waren zur Bedeutungslosigkeit im Chor der Reichsfürsten verurteilt. Durch eine Ungeschicklichkeit zur Zeit der Reformation gingen die Grafen von Steinburg sogar zeitweilig der Reichsunmittelbarkeit verlustig und gewannen sie nur mühsam zurück. Fortan hielten sich die Grafen von Steinburg in ihrer politischen Meinungsäußerung sehr zurück und traten nach außen kaum noch in Erscheinung, um nicht den geringen Erfolg wieder in Frage zu stellen. Aber das Volk der Grafschaft liebte seine Grafen nach wie vor, denn so, wie sie als Könige gerecht gewesen waren, waren sie es auch als Grafen.
Wilzarien, das immer und immer wieder bei der Rückeroberung Aventurs erfolglos gewesen war, sah nach der Zerschlagung Wenglands seine Chance, sich die verlorene Provinz zurückzuholen – und scheiterte bitter. Doch diesmal waren es nicht Wengländer, die Wilzarien besiegten und es wieder freigaben, sondern Vasallenheere des Kaisers, die Wilzarien ebenso wie Wengland in seine Fürstentümer zerstückelten. Aber Wilzarien hatte noch mehr zu leiden. Wengland war ein christliches Land gewesen, Wilzarien verehrte immer noch die alten Götter, die die Wangionen – der ursprüngliche Stamm, der im Zuge der Völkerwanderung in die Verborgenen Lande gezogen war – mitgebracht hatten. Nach der Eroberung durch kaiserliche Truppen wurde das Land brutal christianisiert, die Ausübung des alten Glaubens unter Androhung der Todesstrafe verboten. In Wilzarien wütete die Heilige Inquisition so heftig, dass die Feuer der Scheiterhaufen kaum noch ausgingen. Aber auch Wengland wurde von der Inquisition nicht mehr verschont. Seine Könige hatten die Inquisitoren nie in ihren Grenzen geduldet, aber jetzt fielen sie auch dort ein und suchten mit Eifer nach Ketzern – und fanden sie auch, wenn sie Erfolge brauchten!
Gerade das nun zu Ende gegangene Jahrhundert war für die Grafschaften Wenglands und die Fürstentümer Wilzariens besonders grausam gewesen. Neue Glaubenslehren und die Gegenreformation der alten katholischen Kirche hatten schlimme Spuren hinterlassen. Die Grafschaften des ehemaligen Wengland waren mehrheitlich katholisch geblieben und hatten dafür mit den eher dem Protestantismus zuneigenden Fürsten Breitensteins öfter heftigen Streit gehabt. Doch welcher Zusammenhalt unter den Ex-Wengländern noch immer herrschte, wurde deutlich, wenn das evangelisch-lutherische Oberwengland einer benachbarten katholischen Grafschaft gegen protestantische Angriffe von außen zu Hilfe kam und wenn katholische Grafschaften umgekehrt aushalfen.
Nun war ein neues Jahrhundert angebrochen, aber ob es Frieden bringen würde, war ungewisser denn je. Man rechnete bereits mit einem europäischen Krieg in Glaubensfragen. Jeder, der sich in Europa mit Politik befasste, erwartete einen großen Konflikt am westlichen Rand des Reiches, in den Niederlanden. Ein Teil der Niederlande hatte sich nach langem und zähem Kampf gegen Spanien 1609 endlich selbstständig machen können und einen Waffenstillstand für zwölf Jahre erreicht. Aber niemand von politischer Bildung in Europa erwartete, dass Spanien auch nur einen Augenblick länger mit der Rückeroberung seiner wertvollen Provinzen an der Nordsee warten würde, als der Waffenstillstand es dazu zwang. Aber als der Konflikt dann kam, brach er ganz woanders aus, als erwartet: am entgegengesetzten Ende des Reiches, in Böhmen.
Kapitel 1
Des Feldherrn Page
Es war im Frühjahr 1617, als ein schmächtiger Jüngling beim Grafen Tilly, einem Feldherrn des Herzogs von Bayern, vorsprach und um Aufnahme in dessen Dienste bat. Johann von Tilly ließ den Jungen eintreten.
„Wer bist du und was willst du?“, fragte der ältere General den Jungen.
„Ich bin Wolf von Steinburg und möchte in Euer Liebden Felddienste treten“, erwiderte der Junge mit einer Stimme, die den Stimmbruch knapp überstanden hatte. Wenn sie sich so weiterentwickelte, wie es jetzt den Anschein hatte, würde es einmal eine volle, recht angenehm klingende Stimme sein. Tilly betrachtete den Knaben genau. Wolf war lang aufgeschossen. Arme und Beine wirkten noch viel zu lang ohne eine entsprechende Muskulatur. Unter einem ungeordneten dunkelbraunen Haarschopf, der sehr kurz geschnitten war, fand der Graf ein noch jungenhaftes Gesicht, das die ersten Ansätze von Bartwuchs zeigte. Im völligen Gegensatz zu der noch jugendlichen Erscheinung standen die braunen Augen, die eine Ernsthaftigkeit ausstrahlten, die der General selten an einem so jungen Menschen gesehen hatte. Aber es war noch mehr darin: Intelligenz und Wissbegierde. Solch einen Augenausdruck kannte Tilly nur von einigen Mönchen. In der Regel waren es Jesuiten gewesen, die ihn so angesehen hatten. Er hätte sich den Jungen gut in einer Mönchskutte vorstellen können – aber seltsamerweise genauso im Lederkoller eines Musketiers.
„Wolf – du weißt, dass ich ein General der katholischen Liga bin, ein Feldherr des Herzogs von Bayern?“, fragte Johann von Tilly, um sicherzugehen, dass der Junge sich nicht in der Adresse geirrt hatte und eigentlich zum Kloster Andechs oder Engelberg wollte.
„Ja, Euer Liebden“, bestätigte Wolf in fast militärischem Tonfall.
„Willst du denn Soldat werden?“, hakte Tilly nach.
„Genau, Euer Liebden.“
Tilly schmunzelte vergnügt, als er an die nicht vorhandenen Muskeln dachte.
„Wenn ich dich so betrachte, Wolf von Steinburg, scheinst du mir für die schwere Arbeit eines Kriegsknechtes nicht recht geeignet“, gab der General zu bedenken.
„Meine Vorfahren waren berühmte Ritter, Euer Liebden. Sie alle haben irgendwann mit dem Gebrauch der ritterlichen Waffen begonnen – und bestimmt ist keiner von ihnen in einer Rüstung oder als Muskelpaket geboren“, erwiderte Wolf mit einem erstaunlichen Selbstbewusstsein. Graf Tilly lachte auf.
„Vielleicht hast du die Muskeln noch nicht, aber auf alle Fälle hast du das Herz eines Löwen, mein Junge“, sagte er lachend. „Aber bevor ich ja sage, möchte ich wissen, was deine Eltern dazu sagen, dass du mir dienen willst.“
„Ich kann sie nicht fragen, Euer Liebden, denn meine Eltern leben leider nicht mehr“, erwiderte der Junge mit einem mühsam beherrschten Anflug von tiefer Trauer.
„Woran sind deine Eltern gestorben und wer waren sie?“, fragte Tilly nach.
„Mein Vater war Graf Karl von Steinburg, meine Mutter Gräfin Juliane von Steinburg. Als ich sieben Jahre alt wurde, gaben meine Eltern mich zur Schule in das Kloster Wachtelberg. Vor zwei Jahren erhielt ich die Nachricht, dass meine Eltern umgebracht wurden. Es gibt keine Erklärung, weshalb meine Eltern sterben mussten. Wir sind arm, bei uns gab es nichts zu stehlen. Mein Vater war zwar ein reichsunmittelbarer Graf, aber er war ohne Einfluss. Sein Tod konnte niemandem nützen, der meiner Mutter schon gar nicht. Der oder die Mörder wurden nicht gefunden. Aber eines Tages will ich meine Eltern rächen, Euer Liebden“, erwiderte der Junge mit mühsamer Selbstbeherrschung. Er war kurz davor, in Tränen auszubrechen. Tilly nickte.
„Ich nehme dich an, mein Junge. Du wirst mir zunächst als Page dienen und dann sehen wir weiter.“
Wolf trat also in die Dienste des katholischen Generals, der die Truppen der katholischen Liga befehligte. Die Gründung dieser Vereinigung von katholischen deutschen Fürsten war eine Antwort auf die protestantische Union evangelischer Fürsten des Reiches, welche zur Verteidigung der Religionsfreiheit der Protestanten gegründet worden war. Maximilian von Bayern, das Haupt der Liga, war ein Eiferer für den katholischen Glauben, und es hieß, dass seine Besitzungen am wenigsten vom Protestantismus erfasst waren, der seit Luthers Reformation hundert Jahre zuvor in Europa heftig um sich griff. Die katholische Liga sollte den Katholiken ihre Rechte sichern – und nach Möglichkeit verirrte Schäfchen zum ihrer Ansicht nach rechten Glauben zurückführen, nötigenfalls mit Gewalt. Diese Aufgabe bedingte eine gute Ausbildung und Ausrüstung; Dinge, die der reiche Herzog von Bayern gut finanzieren konnte.
Graf Tilly stellte bald fest, dass sein neuer Page in seiner knappen Freizeit bei einem der Fechtmeister seiner Truppen Unterricht nahm. Der Unterricht fand meist in einer abgelegenen Ecke im Hof statt, die Tilly vom Fenster seines Arbeitskabinetts aber einsehen konnte. Er konnte nicht umhin, die Zähigkeit des Jungen zu bewundern, der offensichtlich keinen größeren Wunsch hatte, als fechten zu lernen. Es war auch deutlich, dass Wolf kein ahnungsloser Anfänger war. Er brachte gute Voraussetzungen mit, die der Fechtmeister vervollkommnete.
Schon im Jahr darauf, am 23. Mai 1618, geschah in Prag Entsetzliches: Die protestantischen Stände und Fürsten revoltierten gegen die Verletzung des Majestätsbriefes von 1609, in dem ihnen Religionsfreiheit und ständische Privilegien zugesichert worden waren. Jetzt, im Frühjahr 1618, hatten die kaiserlichen Statthalter Martinitz und Slavata einen Erlass unterschrieben, der eben diese Privilegien zu bedrohen schien. Der Erlass bezog sich darauf, in zwei zweifelhaften Fällen, die beide zu Lasten von Protestanten entschieden waren, jeden Widerstand im Keim zu ersticken und Unbotmäßige gleich hinter Gitter zu bringen. Der Erlass war kaiserlich gebilligt. Tatsächlich war eine Reihe von Leuten, die die Entscheidung nicht hinnehmen mochten, eingesperrt worden. Die Protestanten, an der Spitze ihr Wortführer Graf Thurn, fühlten sich in ihren Privilegien verletzt, durch die katholische Obrigkeit herausgefordert und handelten mit ähnlicher Grobheit: Graf Thurn und seine Getreuen brachen zornentbrannt mit solcher Macht in den Hradschin ein, die Prager Burg, auf der die kaiserlichen Statthalter residierten, dass die Wachen sie nicht aufhalten konnten. Den Statthaltern wurde ihr Erlass vorgehalten und die Herren samt ihrem Schreiber aus dem Fenster befördert. Zwar bremste ein unter dem Fenster befindlicher Misthaufen den tiefen Sturz der kaiserlichen Statthalter, aber der Würde der hohen Herren diente das Bad im Mist gewiss nicht. Damit nicht genug, feuerten die Aufständischen noch einige Schüsse auf die Fliehenden ab, die jedoch zu deren Glück nicht trafen.
Der Prager Fenstersturz von 1618 wäre sicher nur eine Episode mit unangenehmen Folgen für die unmittelbar Beteiligten gewesen, wären Graf Thurn und die mehrheitlich protestantischen Adligen nicht noch einen Schritt weitergegangen: Sie wollten keinen König, der den Majestätsbrief verletzte. So erklärten sie Erzherzog Ferdinand, den im Vorjahr auch von ihnen selbst gewählten König, Neffe des Kaisers und dessen voraussichtlicher Nachfolger auf dem Thron des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, für abgesetzt und seiner böhmischen Rechte für ledig. An seiner Stelle wählten sie den jungen Kurfürsten Friedrich von der Pfalz zu ihrem König, einen erklärten Protestanten calvinistischer Prägung. Dieser Vorgang war der Tropfen, der das übervolle Fass der Konflikte in Europa zum Überlaufen brachte.
Mit dem Titel des Königs von Böhmen war die Kurfürstenwürde im Reich verbunden. Gerade der König von Böhmen konnte ausschlaggebend sein, welcher Konfession der nächste Kaiser sein würde. Mit einem katholischen König von Böhmen wäre die Wahl eines Habsburgers auf den Kaiserthron sicher gewesen. Mit einem protestantischen böhmischen Kurfürsten wäre der nächste Kaiser vielleicht protestantisch, mit Sicherheit aber nicht aus dem Hause Habsburg gewesen. Das konfessionelle und in diesem Fall auch politische Gewicht des böhmischen Thrones ergab sich daraus, dass die drei geistlichen Kurfürsten des Reiches – die von Köln, Mainz und Trier – Katholiken waren, während drei der weltlichen Kurfürsten – von Sachsen, Brandenburg und der Pfalz – protestantisch waren. Allein an der Person des böhmischen Königs entschied sich damit, wie die Stimmen bei der bevorstehenden Kaiserwahl verteilt sein würden. Und diese Wahl schien nicht mehr fern, denn Kaiser Matthias war 61 Jahre alt und alles andere als gesund.
An der Person des künftigen Kaisers würde aber das Machtgefüge in Europa hängen. Und so wurde aus dem lokalen Aufstand ein Krieg, der sich immer mehr zu einem europäischen Flächenbrand ausweitete, bei dem es um völlig andere Interessen ging, als um die Frage, ob Protestanten Holz von katholischen Gütern nehmen durften.
Erzherzog Ferdinand erhielt zunächst Hilfe von seinen Verwandten in den spanischen Niederlanden, die ein Heer schickten. Die aufständischen Böhmen fanden Hilfe bei der Protestantischen Union und bei dem Berufsfeldherrn Mansfeld, der seine Truppen anbot. Mansfelds Truppen eroberten Pilsen und sicherten damit zunächst den Bestand des protestantischen Königreichs Böhmen. Ferdinands spanische Verwandte begannen, sich von ihm abzuwenden und waren nahe daran, einen anderen Kandidaten für den Kaiserthron zu favorisieren. Aber Kaiser Matthias starb am 20. März 1619, zu früh, um einen neuen Kandidaten zu bestimmen. Die Fürsten des Reiches weigerten sich auch beharrlich, Friedrich von der Pfalz als König von Böhmen anzuerkennen. So wurde der ursprüngliche katholische Kandidat Ferdinand zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gewählt.
Nach der Wahl wollte Ferdinand den böhmischen Aufstand rasch beenden, aber dazu benötigte er mehr Hilfe als bisher. Kaiser Ferdinand hatte nicht die Mittel, seine böhmischen Rechte aus eigener Kraft zu sichern. Er fand in Herzog Maximilian von Bayern einen Helfer, der sowohl die Truppen als auch die Mittel hatte, dem vertriebenen König von Böhmen beizustehen. Maximilian beauftragte seinen Feldherrn Graf Johann von Tilly mit der Führung der Truppen der katholischen Liga, um die Protestanten in Böhmen und ihren nachgewählten König zu bekämpfen.
Wolf war nun zwei Jahre Page bei Johann von Tilly. Aus dem schlaksigen Jungen war ein junger Mann geworden, der sich als entwicklungsfähig und gelehrig erwiesen hatte. Graf Tilly hatte Gefallen an dem klugen, gebildeten und sehr ernsthaften Wolf. Er hielt nichts vom Wettsaufen und Huren, der Lieblingsbeschäftigung der Soldaten in den Lagern. Niemand konnte behaupten, ihn je beim Plündern gesehen zu haben. Wenn der General seinen Pagen mit dem Fouragieren* beauftragte, gab es wahrscheinlich ein Hühnerbein weniger, aber dafür war es den Bauern nicht gewaltsam abgepresst. Es gab Soldaten in Tillys Heer, die von dieser Art des Fouragierens nichts hielten, aber sooft jemand Streit mit Wolf suchte, musste er feststellen, dass sich unter dem stets gepflegten Äußeren des jungen Mannes nicht nur ein Kämpferherz, sondern auch die kräftigen Muskeln eines Kämpfers verbargen. Wenn andere sich in Kneipen und Hurenhäusern amüsiert hatten, hatte Wolf geduldig an seiner fehlenden Kraft gearbeitet. Er hatte Holz in einer Menge gehackt, dass auf Tillys Schloss der Heizvorrat für zwei Jahre nicht ausgehen würde. Er hatte Feldsteine mit dem Hammer zu Geröll zerbröselt. Tillys Schmied hatte Wolf ein Paar handliche Gewichte mit Griffstangen aus Eisen gemacht, mit deren Hilfe Wolf die Armmuskeln gezielt trainieren konnte. Mit dem Fechtmeister hatte er lange Waldläufe gemacht und galt als ausdauernder Läufer und erstklassiger Fechter. Wolf suchte zwar nie Streit, aber er ging auch keinem aus dem Wege, wenn er gefordert wurde. Schon bald hatte er sich den Ruf eines tapferen Soldaten und geschickten Fechters erworben.
Am 23. Juli 1620 überschritt Tillys Ligaheer die Grenze nach Österreich und kämpfte sich nach Prag durch, das böhmische Heer vor sich hertreibend. Anfang November 1620 hatten die Böhmen und die mit ihnen verbündeten Ungarn die Umgebung von Prag erreicht. Aber Herzog Maximilians Ligaheer unter Tilly war ihnen dicht auf den Fersen. Durch den Feuerschein von geplünderten Häusern sichteten Soldaten des Ligaheeres die böhmische Armee, die sich auf dem Weißen Berg verschanzte, einem Kalkberg, der Prag überragt und – hinter einem Flüsschen gelegen – für eine passable Verteidigungsstellung dienen konnte. Das Ligaheer war gewarnt, während die Protestanten von der Nähe ihrer Gegner noch nichts ahnten.
An einem nebligen 8. November war Wolf morgens mit einigen Leuten auf Kundschaft. Sie stöberten einige ungarische Reiter auf, die eilig ins Lager der Böhmen flüchteten und Alarm gaben. Fast gleichzeitig griffen die Ligatruppen unter heftigem Artilleriefeuer an. Zunächst sah es so aus, als würden Tillys Truppen auf dem linken Flügel scheitern, da sie die Stellung, die sie angriffen, nicht nehmen konnten und immer wieder zurückgeschlagen wurden. Unter den immer wieder anrennenden Ligasoldaten am linken Flügel war auch Wolf, der in dem verzweifelten Stürmen keinen rechten Sinn sehen konnte, kostete es doch mehr als genug Menschenleben. Er wollte seinem Herrn den Vorschlag machen, sich irgendwie von hinten heranzumachen, um die Seele des Widerstandes am linken Flügel, Christian von Anhalt junior, außer Gefecht zu setzen, den Sohn des kurfürstlich-pfälzischen Kanzlers Christian von Anhalt senior. Doch bevor er dazu kam, hatten die Herren eine Kampfpause angeordnet und berieten über das weitere Vorgehen. Nach Stunden der Beratung, als die Protestanten schon glaubten, die Bayern würden keinen weiteren Versuch unternehmen, den Weißen Berg zu stürmen, wurde unten die Parole „Salve Regina!“ ausgegeben, die für den entscheidenden Angriff gelten sollte.
Erneut unter starker Artillerieunterstützung griffen die Ligatruppen an, wobei der linke Flügel unter General Tilly wieder arg ins Wanken geriet. Der Einsatz der Reserven kam für die Kaiserlichen zum rechten Zeitpunkt. Mit dieser Unterstützung gelang es den ersten Ligasoldaten, in die Stellung der Protestanten einzudringen. Wolf ignorierte, dass er eigentlich Musketier war, zog sein Rapier und griff mit der Fechtwaffe an. Schon nach wenigen Schritten in der Stellung geriet er an den bereits verwundeten Christian junior und verwickelte ihn in ein hartes Gefecht, dem der geschwächte Anhalter nicht standhalten konnte. Christian fiel, durchbohrt von Wolfs Rapier. Der Tod ihres Anführers löste bei den Böhmen Panik aus. Sie flohen und zerschlugen dabei noch den hinteren Verteidigungsring. Den siegreichen Kaiserlichen fielen das große königliche Banner, hundert Standarten der Böhmen und sämtliche Geschütze in die Hände. Christian von Anhalt senior konnte gerade noch entkommen und seinen Herrn davon überzeugen, dass es besser war, Prag auf der Stelle zu verlassen.
Wolfs Rolle bei der Erstürmung des Weißen Berges sprach sich schnell herum. Tilly beförderte ihn noch auf dem Schlachtfeld zum Fähnrich, was vorzeitig war, denn Wolf war noch nicht volljährig. Später am Abend, als der Hradschin von Maximilians Truppen besetzt war, stellte der General seinen Pagen und neuen Fähnrich dem Herzog von Bayern vor.
„Komm näher, mein Sohn“, winkte der Herzog Wolf heran. Gehorsam trat er näher und verneigte sich tief.
„General Tilly sagt mir, du seiest ein tüchtiger und tapferer Soldat, mein Sohn. Sag’ mir deinen Namen.“
„Wolf von Steinburg ist mein Name, Hoheit“, antwortete Wolf.
„Steinburg in der Grafschaft Bogen an der Donau? Du klingst nicht nach Niederbayern“, hakte Maximilian nach.
„Nein, Herr. Steinburg in der Grafschaft Steinburg im ehemaligen Königreich Wengland“, korrigierte Wolf.
„Bist du mit den Grafen von Steinburg verwandt, mein Junge?“
„Graf Karl war mein Vater.“
„War?“ fragte der Herzog.
„Ja, Hoheit. Meine Eltern leben leider nicht mehr. Ich wurde im Kloster Wachtelberg erzogen.“
„Wirst du dein Erbe antreten?“
„Ja, Hoheit. Der Grafentitel ist alles, was meiner Familie – oder besser: mir – geblieben ist.“
„Hältst du das für zu wenig?“, fragte Maximilian mit tadelndem Unterton.
„Nun, solange es das Königreich Wengland gab, waren die Grafen von Steinburg die Träger der Krone. Aber das Königreich existiert nicht mehr und meine Familie ist verarmt. Deshalb sage ich, dass der Titel alles ist, was mir geblieben ist.“
„Würdest du dir wünschen, dass es Wengland wieder als Königreich gibt?“, forschte der Herzog. Wolf wurde misstrauisch. Wenn Maximilian seinen Wunsch nach einer Wiederherstellung Wenglands falsch deutete, wertete er das als Verrat. Wolf zuckte mit den Schultern.
„Selbst wenn ich es mir wünschen würde, Hoheit: Es ist nicht möglich. Mein Wunsch ist hier ohne Belang“, erwiderte Wolf. Maximilian gab sich mit Wolfs Erklärung zufrieden und entließ den jungen Mann.
Kapitel 2
Die Last des Krieges
Kurz vor seinem einundzwanzigsten Geburtstag erbat Wolf sich etwas Urlaub.
„Und was hast du vor, Wolf?“, fragte Tilly interessiert.
„Ich möchte mein Erbe antreten, Euer Liebden. Ich werde bald volljährig und kann den Titel des Grafen von Steinburg annehmen“, erklärte Wolf.
„Ist dein Erbe sonst noch etwas wert – außer dem Titel?“
Wolf schüttelte ernst den Kopf.
„Nein, Euer Liebden. Ihr wisst ja, meine Familie ist verarmt. Alles, was ich besitze, ist mein Pferd, der Sattel darauf und das, was ich am Leibe trage.“
„Habe ich dich so schlecht entlohnt?“, fragte der General, der sich ein Schmunzeln nicht verkneifen konnte.
„Nein“, lächelte Wolf. „Aber ich werde wohl alles, was mir von der Löhnung geblieben ist, brauchen, um den Notar zu bezahlen.“
„Seltsam“, murmelte Tilly. „Ich habe einmal gehört, die Grafen von Steinburg seien sehr reich.“
„Das waren sie auch, Euer Liebden. Jedenfalls hält sich diese Sage beharrlich in Steinburg. Angeblich soll Graf Ralf, der sich sogar für einige Jahre die Reichsunmittelbarkeit verscherzte, das Geheimnis des Reichtums mit in das Grab genommen haben – und seither sind wir arm wie die Kirchenmäuse.“
„Wir sollten darüber noch einmal reden, wenn du wieder hier bist, mein Junge“, sagte Tilly und warf seinem Fähnrich eine Geldbörse zu. „Nimm einstweilen den Beutel, Wolf. Das sollte für die Reise genügen. Wann wirst du zurück sein?“
„Ich hoffe, alles in einem Monat geregelt zu haben.“
„Geh’ mit Gott, mein Sohn.“
Pünktlich wie angekündigt, kehrte Wolf einen Monat später mündig, volljährig, erwachsen, als Graf von Steinburg betitelt zu Tilly zurück. Sein Erbe hatte er angetreten, auch wenn der mit der Testamentsvollstreckung beauftragte Notar ihm nicht allzu viel Hoffnung gemacht hatte, dass der Königsschatz eines Tages auftauchen würde. Er hatte einen Verwalter für die Belange seiner Grafschaft eingesetzt, ohne dem Mann viel Lohn versprechen zu können. Für den Verwalter war der karge gräfliche Lohn mehr ein Zubrot zu seiner sonstigen Tätigkeit als Advokat.
Als er bei Tilly eintrat, wog er einen kleinen Geldbeutel in der Hand.
„Gott zum Gruße, Euer Liebden“, grüßte er freundlich.
„Gott zum Gruße, Wolf, Graf von Steinburg. Ich beglückwünsche Euch zu Eurem Erbe“, erwiderte der General höflich. Wolf war verwirrt.
„Euer Liebden, sonst habt Ihr mich geduzt“, bemerkte er. Tilly sah ihn lange an.
„Jetzt seid Ihr ein Graf, wir sind also gleichgestellt, auch wenn ich wesentlich älter bin als Ihr, Graf Steinburg“, erklärte er.
„Euer Liebden, ich bin nach wie vor Euer Fähnrich. Nennt mich bitte weiter beim Vornamen. Ihr seid mir ein väterlicher Freund; bitte, erweist mir diese Ehre.“
„Wenn Ihr wollt, gern. Doch dann mache ich Euch das Gegenangebot, mich gleichfalls beim Vornamen zu nennen. Und lasst bloß Euer Liebden weg! Wenn ich eine Bezeichnung nicht leiden kann, dann diese!“
Wolf lachte auf.
„Ich diene Euch jetzt seit vier Jahren, Graf Tilly, aber das habt Ihr mir noch nie gesagt!“
„Kommt, Wolf, setzt Euch. Ich habe noch mehr mit Euch vor“, entgegnete Tilly und bot Wolf Platz an.
Der junge Graf nahm den mit weißen und blauen Federn geschmückten breitkrempigen Hut ab und setzte sich.
„Wolf, Ihr seid mir in den vier Jahren, die Ihr jetzt in meinem Dienst steht, ans Herz gewachsen. Ihr erfüllt das, was ich von Euren Vorfahren gehört habe. Irgendwann waren Eure Vorfahren Könige, oder?“
Wolf nickte.
„Ja, aber das ist schon fast dreihundert Jahre her. Seither ist viel Wasser den Alvedra hinab geflossen“, erwiderte der junge Graf.
„Wolf, ich möchte Euch zu meinem Adjutanten machen. Ihr könnt lesen und schreiben, Ihr könnt mit Zahlen umgehen, was wahrhaft nicht jeder kann. Ihr seid ein gebildeter junger Mann, ein vorbildlicher Soldat und die Ritterlichkeit in Person. Mir ist noch kein Mann wie Ihr begegnet: Arm wie eine Kirchenmaus, aber stets vornehm und vor allem sauber gekleidet. Ihr versteht Euch auszudrücken, was mir altem Soldaten manchmal schwer fällt. Ich denke, Ihr könnt Euch auf politischem Parkett bewegen.“
„Oh, verschätzt Euch nicht … Johann“, gab Wolf zurück, vorsichtig vom Angebot seines Dienstherrn Gebrauch machend. „Der letzte meiner Vorfahren, der es riskierte, sich auf politischem Parkett, wie Ihr es nennt, zu bewegen, hat es mit zehn Jahren Kerkerhaft und für fünfzehn Jahre mit der Reichsunmittelbarkeit bezahlt.“
„Habt Ihr Angst, Euren Titel einzubüßen?“, lächelte Tilly. Wolf nickte.
„Oh, Wolf – Ihr seid katholisch, der Herzog von Bayern ist es auch und der Kaiser ist einer der gläubigsten Katholiken, die mir je begegnet sind. Ihr seid ein tapferer Kämpfer für den Herzog und den Kaiser. Wie sehr Maximilian Euch schätzt, zeigt das edle Pferd, das er Euch nach der Schlacht am Weißen Berge geschenkt hat.“
„Ich bin vorsichtig, Johann. Bei wirklich hohen Herren ist man sich der Gunst nie ganz sicher. Gerade wir Steinburger haben das in den letzten dreihundert Jahren allzu oft erfahren. Zeitweise gehörten wir zum Fürstentum Schwarzenstein, das davor nie etwas mit Wengland zu tun hatte. Der Fürst von Schwarzenstein hat keine Gelegenheit ausgelassen, auch das Grafenhaus kräftig zu pressen.“
„Verwechselt mir meinen allergnädigsten Herrn, den Herzog Maximilian von Bayern, nicht mit dem Schwarzensteiner!“, lachte Tilly auf. „Aber davon abgesehen: Ihr seid jetzt vier Jahre mein Page, und Ihr habt nicht die niedrigsten Arbeiten getan. Ihr seid eigentlich mehr mein Sekretär als mein Page gewesen. So ähnlich wird Eure Aufgabe als mein Adjutant sein, nur, dass ich noch Euren militärischen Sachverstand nutzen möchte. Ich habe noch immer Euer Gebrummel in den Ohren, wie man eine Stellung nur bergauf berennen kann, ohne den Versuch zu machen, den Feind zu umgehen und ihm von hinten in die Waden zu beißen. Vielleicht hätte der Versuch ein paar hundert Leute weniger gekostet.“
„Nun, wenn Ihr es wünscht, will ich Euer Adjutant sein“, erwiderte Wolf lächelnd.
„Euch muss man fast zu Eurem Glück zwingen, Wolf. Außerdem bin ich der Meinung, dass Ihr allmählich Leutnant werden solltet. Als Adjutant geziemt sich dieser Rang. Nehmt Ihr an?“
„Ihr würdet es nicht vorschlagen, wärt Ihr nicht der Meinung, dass ich diesen Posten ausfülle. Ja, ich nehme an, Graf Tilly.“
Tilly schob Wolf ein Pergament hin, das ihn als Leutnant in Diensten der katholischen Liga auswies und einen Vertrag darstellte, der zunächst für fünf Jahre galt. Das entsprach der Übung, nach der sich ein Soldat seinem Feldherrn persönlich verdingte und schriftlich versprach, ihm eine gewisse Zeit als Soldat zu dienen. Der Vertrag konnte aber auch vorzeitig enden, etwa, wenn ein Soldat in Gefangenschaft geriet oder seine Fahne erobert wurde. In diesen Fällen konnte der Soldat sich auch für die Gegenseite entscheiden, was oft genug vorkam, wenn der Gegner besser zahlte. Wolf unterschrieb den Vertrag, Tilly zeichnete dagegen, womit der Vertrag gültig wurde. Der alte General sah seinen Adjutanten eine Weile nachdenklich an.
„Wisst Ihr“, sagte er dann, „Ihr habt mir zwar gerade nur einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben, aber ich glaube, Ihr gehört nicht zu der wetterwendischen Sorte von Soldat, der sich nach Ablauf des Vertrages beim Gegner anbietet.“
Wolf grinste freundlich.
„Auf die Idee wäre keiner meiner Vorfahren gekommen. Mir würde die Ritterehre so etwas verbieten“, versetzte er. „Oh, bevor ich es vergesse: Dieses Beutelchen Gold habt Ihr mir gegeben, als ich fortritt. Ich danke fürs Ausleihen“, sagte er dann und schob Tilly den Beutel zu.
„Das war nicht als Darlehen, sondern als Geschenk gedacht, mein Junge“, erwiderte der alte Graf lächelnd und zwirbelte den weißen Schnurrbart.
„Das kann ich nicht annehmen, Graf Tilly“, wehrte Wolf ab. Tilly lehnte sich zurück.
„Doch, das könnt Ihr, Graf Steinburg. Ihr seid jung und braucht eine gute Grundlage für Eure Zukunft. Ihr seid nicht mein erster Page. Ich habe es immer so gehalten, dass meine Pagen, wenn sie erwachsen wurden, so ein Beutelchen Gold als Geschenk bekamen. Außerdem könnt Ihr es bestimmt gut gebrauchen.“
Wolf versenkte das Ledersäckchen in seinem Wams.
„Dank Euch, Graf Tilly. In der Tat, ich kann es gebrauchen. Als Euer Leutnant brauche ich wohl ein eigenes Rapier*.“
„Dann sucht Euch etwas Gutes aus und nehmt keinen Ramsch. Wartet noch eine Weile. Es könnte sich ergeben, dass wir nach Westfalen kommen. In Solingen gibt es die besten Klingenschmiede. Meister Balduin macht besonders gute Klingen.“
„Es wäre mir ein Vergnügen, mit Balduin zu feilschen“, grinste Wolf.
Doch bis sich Wolfs Wunsch erfüllte, bedurfte es noch verschlungener Pfade durch die deutschen Lande – und auch eines heftigen Streites mit seinem Dienstherrn. Tillys Ligaheer hatte am 6. Mai 1622 den mit Friedrich von der Pfalz verbündeten Markgrafen von Baden und dessen Truppen geschlagen und zog wieder gen Bayern, in die Oberpfalz, die Maximilian von Bayern außer Oberösterreich für seine Hilfeleistung vom Kaiser verpfändet worden war. Es blieb umstritten, ob der Kaiser Gebiete verpfänden durfte, die nicht sein Kronland waren – und die Oberpfalz an der Grenze zu Böhmen war kein Kronland, sondern das Land des Kurfürsten Friedrich von der Pfalz. Kaiser Ferdinand hatte ohne Bedenken Ländereien der Aufständischen zur Deckung seiner Kosten eingezogen. Nun sollten Tillys Truppen dem neuen Landesherrn in der Oberpfalz Respekt verschaffen, einem Gebiet, das im Norden etwas nördlich von Waldsassen an den Fränkischen Reichskreis grenzte, im Süden zwischen Hilpoltstein und Cham lag und dessen westlichsten Rand die Umgebung der freien Reichsstadt Nürnberg bezeichnete.
Weil der Sold schon frühzeitig, nämlich schon im Laufe des Jahres 1621, nur unpünktlich und teilweise unvollständig gezahlt worden war, war aus den ursprünglich disziplinierten Truppen der Liga ein beutegieriger Soldateskahaufen geworden. Erschwerend kam hinzu, dass die Bauern in der Oberpfalz den Katholiken unter Tilly nicht selten Unterkunft und Verpflegung verweigerten. Nur allzu oft fielen die Männer hungrig über Dörfer und Städte her, plünderten, brandschatzten, hinterließen nicht wieder gutzumachende Verwüstungen. Wolf von Steinburg brachte Plünderei in Wut. In der Nähe von Cham hatte er einen plündernden bayerischen Hauptmann derartig verprügelt, dass der Mann für Tage ans Bett gefesselt war. Tilly ließ seinen Adjutanten vom Profos* verhaften.
„Was bildet Ihr Euch eigentlich ein, Graf Steinburg?“, herrschte Tilly Wolf an. „Wie könnt Ihr es wagen, Hauptmann Eggner lazarettreif zu schlagen?“
„Ich kam dazu, wie Eggner eine schon am Boden liegende Bäuerin mit der Reitgerte weiter schlug, um von ihr das Versteck ihres Geldes zu erfahren. Ich habe eingegriffen, und weil Eggner sich dagegen sträubte, musste ich Gewalt anwenden“, erklärte Wolf mit erzwungener Ruhe.
„Das ist nicht Eure Sache, sondern die des Profos!“, wetterte Tilly zornig.
„Der Teufel soll mich holen, wenn ich je zulasse, dass ein ausgewachsener Mann mit einer Gerte auf eine zierliche Frau losgeht, Euer Gnaden! Bis unser Profos auf einen Alarm reagiert, hat eine alte Sau sieben Mal geferkelt! Außer, man verhaftet ehrbare Leute!“, rief Wolf erbittert.
„Der Teufel wird Euch holen, wenn Ihr weiter Eure Kompetenzen überschreitet!“, donnerte Tilly.
„Sagt, Johann: Gegen wen führen wir eigentlich Krieg? Gegen den falschen König von Böhmen oder gegen seine hilflosen Untertanen? Wir pressen die Bauern bis zum letzten Blutstropfen aus und wundern uns, dass sie uns die Unterkunft verweigern …“
„Wir sollen das Land für den Herzog sichern!“, wies Tilly Wolf zurecht. „Wir müssen hier hart durchgreifen.“
„Hart durchgreifen? Indem unsere Männer straflos Frauen vergewaltigen? Indem unsere Soldaten die Bauern erbarmungslos foltern, um an ein paar Pfennige Geldes heranzukommen, das für die Soldaten eher ein Taschengeld ist, den Bauern aber das Überleben sichert? Ist das unser Krieg, Johann? Wenn das so ist, hoffe ich, dass meine fünf Jahre bald um sind, damit ich nach Steinburg zurück kann, um meinen Bauern ein ähnliches Schicksal zu ersparen!“
„Wolf! Ihr seid Soldat! Ihr habt zu gehorchen!“, fuhr Tilly seinen Adjutanten an.
„Heißt das, dass Ihr Hauptmann Eggner den Befehl gegeben habt, diese Bauern so zu quälen? Was ist das für eine Welt, in der man sich an den Schutzlosesten vergreift? Kennt Ihr noch den Rittereid, Graf Tilly? Sei ohne Furcht im Angesicht deiner Feinde! Sei tapfer und aufrecht, auf dass Gott dich lieben möge! Sprich immer die Wahrheit, auch wenn es deinen eigenen Tod bedeutet! Beschütze die Wehrlosen – und tue kein Unrecht! Der Ritter schwört, dass er Unterdrückten und Hilflosen seinen Schutz gewährt. Nichts anderes habe ich getan, als eine hilflose Frau zu schützen, getreu meinem Rittereid! Ich habe ihn noch geschworen, diesen Eid. Zwar nicht einem Landesherrn, aber Gott. Und mir als gläubigem Katholiken bedeutet das etwas, Graf Tilly!“
„Schweigt! Ich verbiete Euch, so mit mir als Eurem Dienstherrn zu reden, Graf Steinburg! Profos, Graf Steinburg hat drei Tage scharfen Arrest bei Wasser und Brot! Und sollten Euch solche Flausen wieder einfallen, endet es das nächste Mal mit Stockhieben, verstanden?“
„Nur zu! Mit den Methoden vergrätzt Ihr nicht nur das Volk, sondern die letzten ritterlich denkenden Soldaten!“, versetzte Wolf ätzend.
„Profos, Graf Steinburg bekommt drei Stockhiebe!“, knurrte Tilly.
Zornbebend verließ der alte General das Zelt des Profos. Das Schlimmste war, dass Wolf Recht hatte. Tilly selbst war auch gegen Plünderei, aber es war die einzige Chance, noch die Gewalt über das Heer insgesamt zu behalten, wenn er seinen Soldaten die Plünderungen mit all ihren Scheußlichkeiten erlaubte. Wenn die Soldaten hungerten und keine Unterkünfte hatten, würden sie bald meutern und nicht nur den Bauern zu schaffen machen, sondern auch den Heerführern. Da fiel die Wahl nicht schwer, die Unannehmlichkeiten auf das Volk zu übertragen, zumal, wenn man damit argumentieren konnte, man strafe die Bauern nur dafür, dass sie den Soldaten des Landesherrn keine Unterstützung gegeben hatten.
Der Profos war nicht zimperlich. Wolf bekam drei Hiebe mit einer starken Weidenrute auf das bloße Gesäß und konnte nach der Bestrafung nicht mehr sitzen. Er ging in dem offenen Pferch zornig auf und ab, was aber beinahe genauso schmerzhaft war, wie sich zu setzen. Wolf versuchte, seine wütenden Gedanken zu ordnen. Er erkannte Tilly nicht wieder. Diese Verwüstungen waren mehr als unnötig. Vor allem würden sie das Volk der Oberpfalz gewiss nicht für den Herzog einnehmen. Wolf wünschte sich, dass Tilly ihm mehr Freiheiten geben möge, damit er die Bauern und Bürger diplomatisch überzeugen konnte, dass Max von Bayern kein so unangenehmer Herr war. Andererseits waren die Bewohner der Oberpfalz eher dem Protestantismus zugeneigt als dem katholischen Glauben – und Maximilian von Bayern duldete kein Abweichen von dem Glauben, den er als den richtigen ansah. Bayern war nicht die Grafschaft Steinburg, wo Wolf seinem Verwalter ausdrücklich religiöse Toleranz befohlen hatte und nicht das Königreich Wengland, in dem jeder glauben konnte, was ihm beliebte, solange er nicht den Teufel anbetete.
Wolf musste einsehen, dass er keine Chance hatte, die Bewohner eines Landes zu schützen, solange er ein Offizier und Adliger niederen Ranges war. Es bedurfte schon des Ranges eines Obersten, um mäßigend einwirken zu können – und einer Menge Geld, denn wer das Geld gab, konnte Weisung geben, was damit zu geschehen hatte. Aber Wolf war arm und wollte nicht selbst zum Plünderer werden, um den Krieg zu beeinflussen.
Die Verstimmung zwischen Graf Tilly und seinem Adjutanten hielt gute drei Wochen an, dann entspannte sich ihr Verhältnis wieder. Johann Terclaes von Tilly hatte keine Freude an Plünderungen, aber er sagte es nicht so geradeheraus wie Wolf. Immer wieder schrieb er um die fälligen Löhnungen, immer wieder wurde er vertröstet.
„Wolf“, sagte er schließlich, „ich gebe zu, dass ich mit meinem Latein am Ende bin. Die Oberpfalz ist leergeräumt, der Herzog schickt keine Löhnungen, keinen Nachschub. Was soll ich tun? Gebt mir einen Rat.“
„Täusche ich mich, oder sind wir nur wenige Meilen von niederbayerischem Gebiet entfernt?“, fragte Wolf.
„Niederbayern ist nur einen Katzensprung von hier. Worauf wollt Ihr hinaus?“
„Nun, der Herzog von Bayern unterhält die Truppen der katholischen Liga. Was läge näher, als die Truppen nach Niederbayern zu führen, wo sie sowohl mit Unterkunft als auch Verpflegung rechnen könnten?“, schlug Wolf vor.
„Wolf, das meint Ihr nicht ernst!“, entfuhr es Tilly entsetzt. „Die Armee in dem Zustand nach Niederbayern zu führen, würde bedeuten, dass sie Niederbayern bis zum letzten Grashalm plündert!“
Wolf grinste in einer Weise, die nur zynisch zu nennen war.
„Ich kann mir denken, dass das weder dem Volk noch dem Herzog passen wird. Das Volk, das gebe ich zu, kann nichts dafür. Genauso wenig, wie die Bauern und Bürger der Oberpfalz etwas für die Fehler ihres alten Herrn können. Wir haben sie bis zum letzten Blutstropfen ausgepresst. Nach unserer Lesart sind sie genauso Untertanen des Herzogs von Bayern wie die Leute in Niederbayern. Der Herzog, Johann, der hat diese Misere verursacht, wenn er Euch ohne Löhnungen und Nachschub lässt. Dummerweise wird er davon sehr wenig spüren, denn bevor Armut seinen Tisch erreicht, gibt es keinen lebenden Bauern mehr. Ihr habt mir mit Rutenstreichen beigebracht, dass einem das Hemd näher ist als das Wams. Folglich lässt man einen anderen für die eigenen Probleme bluten. Was also liegt näher, als dass wir uns unsere Verpflegung von den niederbayerischen Bauern geben lassen?“, erklärte er. Tilly sah den jungen Mann eine Weile an.
„Ihr seid von bestechendem Scharfsinn, Wolf. Stimmt, Ihr habt Recht. Ihr hattet auch Recht, als Ihr mir Eure Meinung zu Plünderung und Brandschatzung gesagt habt. Wie können wir verhindern, dass die Armee den Bezirk Regen ausnimmt wie eine Weihnachtsgans?“
„Zwei Möglichkeiten: Erstens: Die Armee zieht gleich weiter nach Westen in Richtung Pfalz. Das hätte den möglicherweise den Effekt, dass Friedrich aus dem dänischen Exil zurückkehrt, um seine Ländereien zu verteidigen. Er wird nicht allein kommen. Ich vermute, dass Christian von Dänemark gleich mitkommt. Christian ist ein gläubiger Protestant, sieht sich wie Gustav Adolf von Schweden als Verteidiger der protestantischen Glaubensfreiheit. Wie stark er ist, vermag ich nicht zu schätzen. Wir hätten jedenfalls aus dem reichsinternen Krieg einen europäischen gemacht. Ich weiß nicht, ob dies im Sinne des Herzogs oder des Kaisers ist. Diese Möglichkeit sollten wir nur wählen, wenn unsere Herren es ausdrücklich wünschen. Möglichkeit zwei: Ich reite nach Burg Weißenstein bei Regen und verhandle mit dem Herrn über Quartiere für die Soldaten und Verpflegung für wenigstens drei Monate. Solange sie etwas zu beißen haben, kommen sie nicht auf die Idee, zu plündern. Wir könnten den Herren wieder etwas Disziplin beibringen. Vor allem müssen Marketender heran, die unabhängig von ihrer Regimentszugehörigkeit für Nachschub sorgen können, indem sie es den Bauern einfach abkaufen.“
„Seid Ihr Euch im Klaren, was das kostet, Wolf?“, hakte Tilly nach.
„Hängt davon ab, wie die Einkäufer feilschen können. Ich stelle mich gern zur Verfügung. Im Feilschen habe ich Übung. Mir ist schon klar, dass es etwas mehr kostet als bisher. Aber ich würde diesen Weg empfehlen, Johann.“
„Und woher nehmen wir das Geld?“
„Marketender sind Kaufleute, Johann. Wenn sie einkaufen, verkaufen sie auch. Wenn wir wirklich drei Monate Zeit haben, unsere Organisation aufzubauen, könnten wir es schaffen. Ich stelle mir vor, dass wir den Glasmachern in Zwiesel anbieten, ihre Waren zu verkaufen – via Marketender …“
„Wolf, hört auf! Wir sind Soldaten und sollen für unseren Herzog Krieg führen, nicht Handel treiben!“, unterbrach Tilly Wolf.
„Nach meiner Einschätzung haben wir die Wahl zwischen einem europäischen Krieg und drei Monaten Handel mit anschließender Unabhängigkeit der Armee von regelmäßigen Zuwendungen des Herzogs. Ich verstehe selbst vom Verkaufen nichts, aber das hindert mich nicht, die Fähigkeit derer, die das können, zu nutzen“, erwiderte Wolf lächelnd.
Nach zwei Tagen Bedenkzeit erhielt Wolf die Erlaubnis, nach Weißenstein zu reiten, das südlich des Marktes Regen auf den Höhen des Pfahls lag, einem aus weißem Quarz bestehenden Höhenzug, der einen Großteil des Böhmerwaldes von Nordwest nach Südost durchzog. Sein Weg führte den Grafen von Norden her kommend an der Stadt Regen vorbei, deren weit durch das Regental sichtbares Wahrzeichen der strahlend weiße Wehrturm der Pfarrkirche Sankt Michael war, ein trutziger Bau, der immerhin schon rund zweihundert Jahre alt war.
Der Hausherr auf Burg Weißenstein, der herzogliche Pfleger, war mit Wolfs Ansinnen einverstanden und sagte ihm und dem Heer der katholischen Liga Hilfe zu.
„Zwischen der Burg und dem Talabhang hinter Sumpering ist viel Platz, Graf Steinburg. Dort kann Euer Heer lagern. Die Wiesenfläche nördlich vom Thurnhof ist auch sehr geeignet, um Zelte aufzuschlagen. Es gibt reichlich Wild, und es sollte möglich sein, auch anderweitig Proviant zu beschaffen. Ich werde die Ratsherren von Regen herbestellen, um nach Marketendern zu suchen“, bot der Pfleger an. Wolf nahm an und konnte bald annehmbare Bedingungen aushandeln, zu denen Tillys Armee sich regenerieren konnte.
Kapitel 3
Verhandlungsgeschick
Das Quartier, das Wolf für die Truppen der Liga gefunden hatte, war gut, und seit längerer Zeit bekamen die Männer wieder ausreichende Rationen, ohne plündern zu müssen. Als es wieder Frühjahr wurde, trafen auch die Marketender ein, die für die Zwieseler Glasmacher gute Geschäfte getätigt hatten und jetzt als Nachschubeinkäufer mit den Truppen der Liga weiterziehen sollten. Zu den bayerischen Marketendern hatte sich auch ein Mann aus Solingen gesellt, der mit Rapieren, Haudegen und Pikenspitzen handelte, die aus der Schmiede von Meister Balduin in Solingen kamen. Wolf war schon einige Male um den Stand des Händlers gegangen, aber was in der Auslage war, entsprach ganz und gar nicht Wolfs Geldbeutel.
„Sucht Ihr etwas Bestimmtes, Euer Gnaden?“, fragte der Händler beflissen, als er Wolfs interessiertes Suchen bemerkte.
„Ja. Ich suche ein Rapier“, gab der zur Antwort.
„Ich habe die besten Rapiere, die Ihr Euch wünschen könnt, Euer Gnaden. Was wollt Ihr anlegen?“
Wolf nahm den Geldbeutel von der Seite, sah hinein und sagte:
„Zwanzig Reichstaler**.“
Der Händler legte den Kopf schief.
„Nicht eben üppig, Herr.“
„Vielleicht, aber ich bin nur ein armer Soldat, Meister. Außerdem sind für diesen Preis ohne weiteres gute Klingen zu bekommen.“
„Beim hiesigen Dorfschmied vielleicht“, versetzte der Händler. „Meine Klingen verkaufe ich nicht für diesen läppischen Preis.“
Wolf zog höflich den Hut.
„Gut, dann werde ich mich halt beim Dorfschmied bewaffnen“, sagte er und wollte gehen. Der Händler erschrak. So einfach wollte er sich zwanzig Taler doch nicht entgehen lassen.
„Wartet, vielleicht kann ich Euch doch helfen.“
„Zwanzig Taler, keinen Groschen mehr!“, warnte Wolf. „Das ist mein ganzer Reichtum.“
Der Händler winkte ihm und führte ihn in sein Lager, das er im Wagen hinter dem Stand hatte. Dort zeigte er Wolf einige Rapiere.
„Hier, das kann ich Euch für zwanzig Taler bieten.“
„Gehänge?“, fragte der junge Graf.
„Das käme dazu“, erwiderte der Händler.
„Ich glaube, Ihr habt mich falsch verstanden, Meister. Zwanzig Taler für eine gebrauchsfertige Waffe. Dazu gehört wenigstens eine vernünftige Lederscheide mit Dorn.“
Der Händler seufzte.
„Gut, Scheide mit Dorn zum Einhängen inbegriffen“, schnaufte er. Wolf prüfte die vorgelegten Waffen.
„Nichts für ungut, Händler, aber Meisterwerke der Waffenschmiedekunst sind diese Stücke nicht“, sagt er nach einer Weile.
„Nun, Meisterwerke werdet Ihr für den Preis, den Ihr anlegen wollt, gewiss nicht erhalten“, erwiderte der Händler. Wolf nahm eine der Klingen und bog sie durch. Die schmalen Klingen verbogen sich bei einem heftigen Gefecht leicht. Eine gewisse Durchbiegefähigkeit war deshalb unerlässlich, wenn die Klinge nach einem Gefecht wieder geradegebogen werden sollte. Die Waffe, die Wolf in der Hand hielt, zeigte bedrohliche Risse.
„Diese Klinge überlebt keine drei Gefechte, Meister. Sie ist schlicht minderwertig. Die ist keine zwanzig Taler wert. Die beiden anderen sind nicht gerade. Wenn Ihr mir für zwanzig Taler nichts Besseres bieten könnt, suche ich mir wirklich einen anderen Lieferanten“, erklärte er.
Der Händler war verblüfft, dass ein offensichtlich so junger Mann so viel von Waffen verstand. Recht zögernd gab er eine Auswahl von Klingen heraus, denen der Preis angemessen war. Schließlich hatte Wolf ein Rapier gefunden, das seinen Preis- und Qualitätsansprüchen genügte. Er zählte aus dem Beutel zwanzig Taler ab und schob sie dem Händler hin.
„Ihr seid ein Schwindler, Herr!“, entfuhr es dem Händler. „Ihr sagtet, Ihr hättet nur zwanzig Taler.“
„Zwanzig Taler sind mein Reichtum, Meister, mein Überfluss. Vom Rest muss ich mir noch ein Mittagessen leisten“, lachte Wolf auf und ging fort.
Auf dem Weg kam er bei einem Goldschmied vorbei. Sein Blick fiel auf den schmucklosen Griffkorb seines neuen Rapiers. Kurz entschlossen trat er bei dem Goldschmied ein.
„Gott zum Gruße, Meister. Ich würde mir gern dieses Rapier verzieren lassen. Was nehmt Ihr für eine goldene Wappenlilie?“
„Grüß Gott, Euer Gnaden. Das kommt ganz auf die Größe der Lilie an. So groß wie Euer Ring macht es zehn Taler und drei für das Befestigen.“
„Zehn Taler für eine daumennagelgroße Lilie? Ihr scherzt. Ich gebe Euch drei für die Lilie und einen halben für ‘s Montieren.“
„Drei Taler? Da kostet mich das Material ja mehr, als Ihr mir für die ganze Arbeit bezahlen wollt!“, widersprach der Goldschmied. „Acht und einen für die Montage.“
„Ihr habt hier fertige Lilchen mit Regenbogen, die sollen vier Taler kommen“, sagte Wolf und nahm aus einem Körbchen eine etwas mehr als daumennagelgroße Lilie mit einem Regenbogen darüber in die Hand. Es war das Regener Stadtwappen. „Da sind sogar schon Zapfen zum befestigen dran. Ich nehme diese Lilie hier, erlasse es Euch, den Bogen abzuzwacken und gebe Euch für alles fünf Taler.“
„Sechs“, forderte der Schmied.
„Abgemacht, aber dann ohne den Bogen.“
Mit unüberhörbarem Seufzen stimmte der Goldschmied zu.
„Nur … wo soll ich die Lilie befestigen, Herr?“
Wolf sah sich das Rapier näher an, bemerkte dann, dass sich in dem großen Griffkorb ein schwarzer Lederschutz auf der Fehlschärfe befand. Er zog die Waffe aus der Scheide, zog mit etwas Mühe den Lederschutz ab und gab ihn dem Goldschmied.
„Da dran hätte ich’s gern.“
Wenig später kam Wolf aus dem Goldschmiedeladen mit einem hübsch verzierten Rapier wieder heraus. Er hatte für einen geradezu lächerlichen Preis ein meisterhaft geschmiedetes Rapier mit einer Lilienverzierung bekommen, wie es sich für einen Grafen von Steinburg gehörte. Er erinnerte sich, dass sein Vater für sein Rapier glatte fünfzig Gulden** und für die Wappenverzierung noch einmal zwanzig Gulden bezahlt hatte. Obwohl der Reichstaler etwa eindreiviertel Steinburger Gulden wert war, hatte er kaum Zweidrittel dessen bezahlt, was sein Vater schon vor über zehn Jahren hatte anlegen müssen.
Seines Vaters Rapier – das einzige Stück außer dem Original-Siegelring, das bei dem Überfall auf seine Eltern abhanden gekommen war. Wolf geriet wieder ins Grübeln, wer so ein Interesse an diesen Dingen gehabt haben konnte, dass er dafür zwei Menschen bestialisch ermorden musste. Oder war es einfach nur Zufall gewesen? Der Siegelring war der Grafenring gewesen, ein sehr altes Stück, das zwar historischen Wert hatte, aber eigentlich ausgemustert werden sollte, weil die Siegelfläche nach fast fünfhundert Jahren ständigen Gebrauchs abgenutzt war und das Metall des Ringes durch häufiges Umarbeiten brüchig geworden war. Nur der chronische Geldmangel hatte Graf Karl daran gehindert, den Ring zu ersetzen. Das Rapier war keine besonders wertvolle Klinge, neigte zum Rostansatz und musste deshalb ständig geputzt werden. Nur die Perlmuttereinlage im Griff, in die noch eine Lilie eingelegt war, gab der Waffe einen gewissen Wert. Aber weder der Ring noch das Rapier würden dem Räuber viel Geld einbringen. Wolf brach den Gedanken ab, weil er sich wie so häufig mit den Überlegungen im Kreis drehte, ohne eine Lösung zu finden.
Als er zu Tilly zurückkehrte, bemerkte der das neue Rapier und bat Wolf, ihm das neue Stück zu zeigen.
„Was habt Ihr dafür bezahlt?“, fragte Tilly interessiert.
„Zwanzig Taler und sechs für die Verzierung.“
„Ho, Ihr seid besser als ein Muselmann!“, lachte der General auf. „Klingen aus Solingen, speziell die von Meister Balduin, sind sonst nicht unter sechzig Talern zu haben – ohne Scheide versteht sich.“
Tilly war endgültig überzeugt, dass Wolf aus seinem chronischen Geldmangel etwas zu machen gelernt hatte. Noch nie hatte er den jungen Mann unordentlich oder unsauber gekleidet gesehen. Wolf war von altem Adel und war sich dessen bewusst, dass bestimmte Verhaltensweisen und Äußerlichkeiten von ihm erwartet wurden.
Die politischen Verhältnisse hatten sich Anfang 1623 ein wenig gewandelt. Die Oberpfalz war für Maximilian gesichert, die Aufständischen von Böhmen waren verhaftet, die Anführer hingerichtet worden. Nur die Spitze des Königreiches Böhmen hatte sich retten können. Friedrich von der Pfalz war mit wenigen Getreuen nach Holland geflüchtet. Sein Weg hatte ihn in die protestantischen Niederlande geführt, da auch seine Ländereien in der westlichen Pfalz insgesamt an den Herzog von Bayern gegeben worden waren. Zwar blieb die Besitzung in der Familie, da Maximilian wie Friedrich aus dem Hause Wittelsbach war, aber verfassungsrechtlich konnte man darüber streiten, ob der Besitz auf einen Vetter übertragen werden konnte, wenn der ursprüngliche Lehensmann politisch missliebig geworden war. Doch Kaiser Ferdinand hatte erhebliche Schulden bei Herzog Max. Und da Friedrich nicht willens war, den Kaiser um Verzeihung zu bitten, wurde er mit der Reichsacht* und Entzug seiner Ländereien bestraft, was die protestantischen Fürsten auch nicht ohne weiteres hinnehmen wollten. Sie machten sich daran, eine europäische Koalition gegen den Kaiser und seine katholischen Verbündeten zu schmieden.
Im Frühjahr 1623 hatte sich das Geschehen nach Westen verschoben, wo diese Koalition sich bereit machte, Ferdinand und seine Verbündeten anzugreifen. Dazu kam, dass zwei geistliche Fürstentümer, nämlich Halberstadt und Osnabrück, gerade vakant geworden waren und nun beide Parteien danach strebten, diese Lehen für sich zu gewinnen. Durch verloren gegangene Briefe der Koalitionspartner, die zu deren Unglück dem Kaiser selbst bekannt wurden, war Ferdinand unterrichtet und hatte einen greifbaren Grund, Maximilian von Bayern zu ersuchen, seine Truppen nach Nordwesten in Marsch zu setzen. Herzog Max entsandte seine Ligatruppen, nun auch noch verstärkt um kaiserliche Truppen.
Die kaiserlich-ligistischen Truppen rückten aus Niederbayern ab und erreichten die Grenze des niedersächsischen Reichskreises, der sich zwischen Weser und Elbe erstreckte, am 13. Juli 1623. Dort, im niedersächsischen Kreis, befand sich Christian von Braunschweig, der Anspruch auf das Bistum Halberstadt erhob, das Kaiser Ferdinand aber schon für seinen Sohn Leopold verplant hatte. Christian war entschlossen, sich dieses Bistum mit Hilfe des Feldherrn Ernst von Mansfeld und dessen Truppen zu sichern. Doch die erhoffte Hilfe Mansfelds blieb aus, und Christian blieb nichts übrig, als vor Tillys anrückenden Truppen zu fliehen, da die kaiserlich-ligistische Armee der seinen zahlenmäßig deutlich überlegen war. Christian setzte sich in Richtung niederländische Grenze ab, konnte sie aber nicht mehr erreichen, weil die Vorhut von Tillys eilig marschierender Armee ihn am 6. August bei Stadtlohn einholte und zum Kampf stellte.
Der kluge General, von seinem Adjutanten über den beginnenden Kampf unterrichtet, ließ Artillerie und Fußtruppen langsam nach vorn rücken, verstärkte die bereits im Kampf befindliche Vorhut, die die Braunschweiger Truppen derart attackierte, dass die an den Flanken stehende Reiterei Christians schließlich in die Flucht getrieben wurde – und die Flucht sämtlicher Braunschweiger verursachte. Das gesamte Material zurücklassend, konnten sich gerade mal zweitausend Braunschweiger mit ihrem wegen ihres Versagens zornigen Anführer Christian über die holländische Grenze retten. Über viertausend von ihnen gerieten in Gefangenschaft.
Unter den Verwundeten des kaiserlichen Heeres befand sich auch Wolf von Steinburg. Er war bei seinen Bemühungen, Graf Tilly über die Entwicklung auf dem Laufenden zu halten, allzu tollkühn an der vordersten Frontlinie entlang geritten und war von einer Kugel in die rechte Schulter getroffen worden. Noch eine Stunde nach seiner Verwundung hatte er einen Bericht abgegeben, war aber Tillys Ordonnanz in die Arme gefallen. Der eilig herbeigerufene Feldscher hatte Wolfs Bewusstlosigkeit ausgenutzt und die Kugel aus der Schulter operiert. Er erwachte im Zelt seines Dienstherrn, als die Schlacht schon gewonnen war. Tilly war mit einigen Schriftstücken beschäftigt, als er bemerkte, dass sein Adjutant in die Wirklichkeit zurückfand.
„Nun, wie fühlt Ihr Euch?“, fragte er und legte die Papiere beiseite.
„Teufel auch!“, entfuhr es Wolf. „Mir tut die rechte Schulter weh! Sollte ich mir bei der ewigen Feuchtigkeit Rheumatismus oder Gicht geholt haben?“
Johann von Tilly lachte schallend.
„Hier, das ist Euer Rheuma: Blei!“, prustete er und zeigte Wolf die deformierte Kugel, die der Arzt aus der verletzten Schulter geholt hatte. Wolf nahm die Kugel mit der gesunden Linken und betrachtete sie genau.
„Ich erinnere mich an einen Schlag an der rechten Schulter, aber ich war zu sehr damit beschäftigt, die Lage zu prüfen, als mich um die Schulter zu kümmern. In der Anspannung habe ich es wirklich nicht bemerkt. Ich dachte, mich hätte ein Stein oder ein Holzstück getroffen. Als es passierte, explodierte gerade ein Pulverwagen in der Nähe“, sagte er. „Verfolgen wir die Braunschweiger?“, fragte er dann unternehmungslustig.
„Ihr werdet mir jedenfalls nicht in der Vorhut traben! Bei Euch pickt wohl der Buntspecht!“, bremste Tilly. „Ihr werdet zunächst Eure Wunde auskurieren und dann bleibt Ihr erst einmal in meiner Nähe.“
„Lagerleben ist so schrecklich langweilig! Ich brauche Arbeit!“, maulte Wolf.
„Die habt Ihr hier mehr als genug!“, versetzte der General. „Kommt aus Wolkenkuckucksheim wieder zurück und werdet wieder vernünftig. In erster Linie seid Ihr mein Adjutant und habt mir bei der Führung dieser Armee zu helfen. Ich lasse Euch gern mal am langen Zügel laufen, weil die Jugend nun einmal Bewegung braucht, aber jetzt muss ich Euch wieder an die Kandare nehmen, sonst werdet Ihr übermütig.“
Wolf setzte sich auf.
„Gewiss, Ihr habt Recht. Aber Freiheit ist wie eine Sucht. Einmal davon geschmeckt, möchte man mehr davon.“
„Ihr seid ein guter Kundschafter, das ist nicht zu bestreiten. Es gibt nur wenige, die so kühn kundschaften wie Ihr. Aber Ihr seid manchmal etwas zu risikobereit, Leutnant von Steinburg. Ich muss Euch bremsen, sonst brauche ich bald einen neuen Adjutanten. Und so einen wie Euch finde ich nur schwer wieder.“
„Ich seh ‘s ein“, seufzte Wolf. Er zuckte im Reflex mit den Schultern, was sich sofort rächte, weil ihm die Verwundung starke Schmerzen verursachte.
„Wir werden noch zwei oder drei Tage hier bleiben. Mansfeld sitzt mit seinen Truppen nordwestlich von Münster. Ich möchte ihm nicht zu viel Gelegenheit geben, sich abzusetzen und den Krieg gegen uns wieder aufzunehmen, nachdem er uns Christian von Braunschweig so freundlich überlassen hat. Wir haben für heute Abend eine Einladung zu Adolf von Braunsberg, einem Grafen hier ganz in der Nähe. Fühlt Ihr Euch gut genug, um zum Siegesfest bei Graf Braunsberg mitzukommen?“
„Was soll ich dort?“, fragte Wolf verblüfft. Er war es nicht gewohnt, zu Festen eingeladen zu werden. Und ein Siegesfest zu diesem Zeitpunkt schien ihm etwas übertrieben.
„Oh, Wolf, mein Ahnungsloser: Das gehört mit zu Euren gesellschaftlichen Verpflichtungen“, erinnerte Tilly. „Aber wenn Ihr Euch nicht gut genug fühlt …“
„Ach was! Wenn Ihr noch Berthold mitnehmt, sitze ich allein vorm Schachbrett. Danke, nein. Ich komme mit.“
Kapitel 4
Die Rose von Stadtlohn
Am Abend trafen Graf Tilly, sein junger Adjutant und Diener Berthold auf dem Gut von Graf Braunsberg wenige Meilen außerhalb von Stadtlohn ein. Diener in kostbaren Livreen nahmen den Soldaten die Mäntel ab und wiesen ihnen den Weg in den Festsaal.
„Guter Himmel!“, entfuhr es Wolf leise. „Johann, das muss ein Stück vom Paradies sein! Wenn wir unsere Truppen hier nicht satt bekommen, weiß ich nicht, wo das möglich sein soll!“
„Braunsberg soll der Geiz in Person sein, habe ich gehört. Der rückt freiwillig nichts ‘raus“, widersprach Tilly ebenso leise.
„Was soll dann dieses Fest?“
„Das weiß ich nicht. Hört Euch um, Wolf.“
Tilly wurde schnell von anderen hohen bayerischen Offizieren in Anspruch genommen, und Wolf sah dem munteren Treiben im Ballsaal zu. Nur wenige Gäste waren Soldaten des Kaisers oder der Liga, die meisten anderen – so vermutete Wolf – waren Bürger von Stadtlohn, die froh waren, dass ihre Stadt verschont geblieben war.
‚Will Braunsberg die katholischen Soldaten mit dem Fest beruhigen, sie davon abhalten, die Stadt zu plündern? Wenn ja, hätte er uns besser nicht hierher eingeladen. Der Luxus hier reizt doch sehr, sich was einzustecken’, dachte Wolf. Er lehnte sich an einen Pfeiler, beobachtete die Leute und korrigierte gelegentlich seine rutschende Armschlinge.
„Ihr seid so allein, mein Herr“, hörte er plötzlich eine weibliche Stimme neben sich. Wolf kam aus seinen Gedanken zurück und verneigte sich höflich, verzichtete aber auf einen tiefen Kratzfuß.
„Verzeiht, wenn ich mich nicht tiefer verbeuge, aber das fällt mir im Moment schwer“, sagte er und deutete einen höfischen Handkuss mit der linken Hand an. Der Handkuss galt einer jungen Frau, die ungefähr in Wolfs Alter sein mochte. Weiches, dunkles Haar fiel ihr in lockeren Wellen auf die schmalen Schultern, graugrüne Augen lächelten den jungen Grafen an.
„Erlaubt mir die unverschämte Frage, wer Ihr seid?“, fragte die junge Dame.
„Ich bin Wolf von Steinburg, Adjutant Seiner Exzellenz General Graf Tilly“, antwortete Wolf.
„Seid Ihr dann Offizier?“
„Ja, ich bin Leutnant. Und wer seid Ihr?“
„Ich bin Katharina von Braunsberg, die Tochter des Hausherrn“, antwortete sie. Wolf verneigte sich erneut.
„Euer Vater muss ein glücklicher Mann sein, wenn er eine so schöne Tochter hat“, machte er ihr ein ehrlich gemeintes Kompliment. Er war sicher, noch nie eine so schöne Frau gesehen zu haben. Das weiche Haar umrahmte ein ebenmäßiges Gesicht mit zarter Pfirsichhaut, die zum Streicheln geradezu einlud. Katharina zuckte leicht mit den Schultern.
„Manchmal glaube ich, er hätte lieber einen Jungen gehabt, der die Ware besser schützen kann als ein Mädchen“, seufzte sie.
„Euer Vater ist Adliger – und Kaufmann?“, wunderte sich Wolf. Das passte mit dem Selbstverständnis des europäischen Adels nicht zusammen, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen.
„Seht das nicht so eng, Leutnant. Adel allein macht nicht satt“, erwiderte sie lächelnd.
„Da habt Ihr nur zu Recht!“, seufzte Wolf und dachte an seinen stets dünnen Geldbeutel.
„Euer Glas ist leer“, bemerkte die junge Frau. „Möchtet Ihr noch etwas Wein?“
„Ja, gern, aber ich hätte auch gern etwas Wasser zum Verdünnen“, bat er.
„Holla, ein Soldat, der nicht trinkfest ist?“, lachte sie.
„Ich habe heute Nacht noch viel zu tun. Irgendwer muss General Tilly wieder nach Haus bringen. Dafür muss ich halbwegs nüchtern sein“, erwiderte er ernsthaft.
„Ihr seid so ernst, Leutnant von Steinburg. Alles amüsiert sich und ist fröhlich – nur Ihr nicht. Freut Ihr Euch nicht über den Sieg?“
Er lächelte leicht. Das sanfte Lächeln und die Wärme seiner braunen Augen erzeugten bei ihr einen wohligen Schauer. Sie konnte sich nicht erinnern, dass ein Mann sie je so angeschaut hatte.
„Euer Vater lässt unseren Sieg in einer Schlacht feiern, als hätten wir den Krieg gewonnen. Ich fürchte, der Krieg ist noch nicht vorbei. Aber davon abgesehen: Vielleicht denke ich zu viel nach, aber ich muss es tun. Tilly braucht einen Adjutanten, auf den er sich verlassen kann“, entgegnete Wolf zurückhaltend.
„Verzeiht, dass ich so aufdringlich bin, aber seit Kriegsbeginn waren hier nur alte Männer oder ausgesprochen raue Soldaten. Ihr seid so anders, Leutnant von Steinburg. Wollt Ihr mir die Ehre des nächsten Tanzes geben?“
„Fern sei es von mir, Euch zu beleidigen, Fräulein von Braunsberg, aber ich fürchte, meine kleine Behinderung wäre einem schönen Kontertanz mit Euch nicht zuträglich“, entschuldigte sich Wolf und wies auf den verwundeten Arm.
„Seid Ihr schwer verwundet?“, fragte Katharina besorgt nach. Er schüttelte lächelnd den Kopf. Es war ein wundervolles Lächeln, das sie schlicht verzauberte.
„Nein, zum Glück nicht; aber es ist schmerzhaft“, sagte er leise.
„Darf ich dem armen, verwundeten Soldaten trotzdem Gesellschaft leisten?“, fragte sie sanft.
„Ich habe nichts einzuwenden. Wollt Ihr mir den Gefallen tun, mich einfach Wolf zu nennen?“
Ihr gefiel der warme Schimmer in den braunen Augen ihres Gegenübers. Irgendwie kam er ihr bekannt vor, aber sie hätte nicht sagen können, woher sie glaubte, ihn zu kennen.
„Wenn Ihr mir die Ehre tut, mich Katharina zu nennen, will ich Euch gern beim Vornamen nennen“, erwiderte sie freundlich.
„Haltet mich bitte nicht für einen Gierhals, aber habt Ihr etwas dagegen, einen Happen mit mir zu speisen?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Durchaus nicht“, sagte sie. „Das Büfett ist nicht zum Anschauen da.“
Er bot ihr den gesunden linken Arm, in den die Komtesse sich auch gern einhakte. Er geleitete sie zu dem reichhaltigen Büfett. Die jungen Leute nahmen sich von den appetitlichen Häppchen und speisten gemeinsam im Stehen.
„Erzählt mir ein bisschen von Euch, Wolf“, bat sie.
„Ihr seid neugierig, Komtesschen“, erwiderte er mit herzlichem Lächeln.
„Oh, jemand wie Ihr macht neugierig. Ihr müsstet der jüngste Adjutant sein, den Tilly jemals hatte. Gestattet mir die Frage nach Eurem Alter?“
„Ich bin dreiundzwanzig“, gab er zurück. „Und Ihr?“
„Wolf – so etwas fragt man eine Dame nicht!“, entrüstete sich Katharina. Gleichzeitig war ihr sein Interesse sehr angenehm.
„Wenn sie selbst neugierig ist, schon. Also?“, erwiderte er und neigte sich leicht zu ihr.
„Zwanzig“
„Schön, Ihr habt mir meine Frage beantwortet; also stille ich auch Eure Neugier: Ich bin der letzte noch lebende Nachkomme eines alten Adelsgeschlechtes, der Grafen von Steinburg. Meine Eltern starben früh, und ich wusste nichts Besseres, als unbedingt Soldat werden zu wollen. Mit siebzehn Jahren trat ich als Page in Tillys Dienste und war noch ein recht schmächtiges Kerlchen. Als ich volljährig wurde, konnte ich meinen Grafentitel zwar annehmen, aber Ihr habt schon Recht, dass Adel allein nicht satt macht. Die Ländereien meiner Familie wurden eingezogen, nachdem einer meiner Vorfahren im Ritterkrieg 1525 den Fehler gemacht hatte, sich auf die Seite der Aufständischen zu schlagen und auch noch Protestant wurde. Obendrein verlor er auch noch die Reichsunmittelbarkeit. Der Fehler wurde zwar revidiert, und Graf Ralf kehrte reumütig in die Arme der katholischen Kirche zurück, aber es war zu spät. In den fünfzehn Jahren, die Steinburg nicht selbstständig war, haben die Herzöge von Schwarzenstein uns so ausgesogen, dass die Familie verarmte und der Verlust auch nicht aus den zurückgegebenen Ländereien gedeckt werden konnte. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus und besitze kaum mehr als das, was ich auf dem Leibe trage. Mein General bezahlt mich gewiss nicht schlecht, aber davon wird man nicht gerade Fugger persönlich. Ich will mich nicht beklagen, ich hungere nicht, aber ich könnte mir Besseres vorstellen.“
„Man sieht es Euch nicht an, dass Ihr nicht gerade im Geld schwimmt“, entgegnete Katharina, deren Blick über Wolfs Kleidung glitt. Seine Sachen wirkten dezent und sauber, seiner Stellung als Adjutant des Generals und seinem Rang als Graf aber angemessen. Sie sahen keinesfalls billig oder minderwertig aus.
„Ich gebe mir Mühe, Katharina. Außerdem habe ich das Talent eines orientalischen Basarhändlers.“
„Habt Ihr das schon einmal eingesetzt, um etwas zu verkaufen?“
„Nein, nur zum Einkaufen. Ich erstehe Euch die schönsten Stücke zum halben Preis, da habe ich keine Schwierigkeiten. Aber mit Verkaufen verdiente ich nicht das Salz zum Brot, geschweige denn die Butter“, erwiderte er mit warmem Lächeln.
„Mein Vater ist Tuchhändler. Er hat mit der alten Tradition gebrochen, dass Adlige eben Müßiggänger oder Soldaten sind. Er ist recht zufrieden damit.“
„Glaube ich gern, wenn ich mich hier so umsehe. Schützt Euren Reichtum nur gut vor den Horden der Protestanten“, schmunzelte er.
„Nun, Herr Adjutant – wir hoffen, dass Ihr das für uns übernehmt“, lächelte sie süß.
„Daher weht also der Wind für die Einladung, hm?“, forschte er mit schelmischem Lächeln.
„Kann man so sehen“, erwiderte die Komtesse spitzbübisch.
„Erzählt Ihr mir doch ein wenig von Euch und Eurem Handel“, bat er.
„Oh, mein Vater kommt ursprünglich aus dem Herzogtum Preußen, aus Braunsberg eben. Er war früher Protestant, hatte aber in dem polnischen Lehen seine Schwierigkeiten, die auch nicht aufhörten, als er zum Katholizismus konvertierte. Er ist aus Preußen ausgewandert und suchte in der Grafschaft Eichgau eine neue Heimat. Aber er musste von etwas leben und erkannte, dass Adel zwar alle Türen öffnet, aber den Magen nicht füllt. So hat er angefangen, mit Tuchen zu handeln, musste aber feststellen, dass Eichstadt dafür nicht die richtige Gegend war. Er versuchte es in Hamburg, in Bremen, in Amsterdam. Man nahm ihn dort nicht auf, weil er Katholik war. Deshalb versucht er es nun von Stadtlohn aus, und es geht einigermaßen. Er sucht nach einem Nachfolger, weil er nicht glaubt, dass ich das Geschäft übernehmen kann.“
„Gibt es erbrechtliche Hindernisse?“
„Den genauen Hintergrund kenne ich nicht. Er hofft jedenfalls, mich reich zu verheiraten.“
„Darunter macht er ‘s nicht, hm?“
„Kaum“
„Jetzt werde ich vollends neugierig: Wie sieht Eure Mitgift aus?“
„Wolf, das genügt erst einmal“, bremste Katharina.
Er sah sie eine Weile an.
„Ihr wärt eine Frau, für die ein Mann alles tun würde“, sagte er dann langsam.
„Und Ihr? Würdet Ihr das auch tun?“, hakte sie nach.
„Nun, ich halte mich für ritterlich und behaupte einfach, ich würde mein Leben für Euch wagen.“
Sie winkte belustigt ab.
„Oh, Herr Leutnant, Soldaten sagen so viel daher“, lachte sie.
„Ich verlange nicht, dass Ihr mir jedes Wort glaubt, liebe Katharina, aber vielleicht habe ich irgendwann Gelegenheit, Euch die Aufrichtigkeit meiner Worte zu beweisen“, erwiderte er leise.
„Lieber Wolf“, entgegnete Katharina sanft und legte ihm vertraulich eine Hand auf den gesunden Arm, „Soldaten stehen in dem Ruf, erstens bei jeder Gelegenheit aufzuschneiden und zweitens nicht treu zu sein.“
Er zuckte mit der gesunden Schulter.
„Was immer ich jetzt sage, um Euch klar zu machen, dass ich zu der Sorte Mann gehöre, die meint, was sie sagt – Ihr würdet mir doch nicht glauben. Also warte ich auf eine bessere Gelegenheit“, sagte er leise. Er war nahe daran, sie einfach zu küssen.
„Hoffentlich nicht auf die Gelegenheit, meine Tochter zu entführen, Herr!“, polterte eine dunkle, scharfe Stimme neben den jungen Leuten. Die vertrauliche, schon fast romantische Stimmung war schlagartig fort.
„Kathrin, wir haben noch andere Gäste. Kümmere dich um sie!“, befahl Graf Braunsberg.
„Ja, Vater“, erwiderte Katharina mit gesenktem Kopf. „Ihr wollt mich bitte entschuldigen, Graf Steinburg?“
„Gewiss, Komtesse.“
Wolf verneigte sich höflich, als sie ging. Dann wandte er sich an Graf Braunsberg.
„Ihr habt eine wunderbare Tochter. Ich beglückwünsche Euch zu diesem Juwel.“
„Ihr seid der Graf Steinburg?“
„So ist es“, bestätigte Wolf.
„Man sagt, Ihr wärt nicht eben reich“, stellte Braunsberg fest.
„Stimmt. Ich verdiene mir mein Brot als Adjutant von General Tilly.“
„Sieh an: Landsknecht!“, erwiderte Braunsberg. Die Berufsbezeichnung spie er aus wie Gift und Galle.
„Soldat, verehrter Graf Braunsberg“, korrigierte Wolf den Hausherrn ungerührt. „Jeder muss leben. Ihr habt Euch aufs Handeln verlegt, ich überlebe immer noch mit der Waffe in der Hand.“
„Manchmal nur knapp, was?“, spöttelte der Tuchhändler mit deutlichem Hinweis auf Wolfs Verwundung.
„Berufsrisiko“, entgegnete Wolf kühl. „So, wie Euch eine Ladung Tuch gestohlen werden kann, kann mich eine Kugel treffen.“
Einen Moment war Schweigen, in dem die Männer sich eher lauernd beobachteten.
„Sagt, Graf Braunsberg, was würdet Ihr davon halten, wenn ich um die Hand Eurer Tochter anhalten würde?“, fragte Wolf schließlich.
„Nichts!“, entgegnete Braunsberg kalt. „Ihr seid nichts und Ihr habt nichts, Graf Steinburg.“
„Dass ich nichts habe, ist zunächst einsichtig, aber dass ich nichts bin, trifft nicht zu. Ich bin von altem Adel“, versetzte Wolf.
„Die Grafen von Steinburg, werter Herr, sind seit Jahrhunderten bedeutungslos. Der Königsschatz scheint nur Legende zu sein. Solange Ihr den nicht ans Tageslicht gebracht habt, gebe ich Katharina lieber einem bürgerlichen Kaufmann zur Frau, der ihr einen angemessenen Rahmen bieten kann, als einem adligen Schwiegersohn, der nicht weiß, wie er die Mäuler seiner Familie am nächsten Tag stopfen soll. Im Übrigen bin ich allergisch gegen Erbschleicher!“
„Herr von Braunsberg, Ihr mögt reicher sein als ich, aber das gibt Euch nicht das Recht, mich einen Erbschleicher zu nennen!“, knurrte Wolf gallig.
„Oh, habt Ihr mich so missverstanden? Das tut mir Leid. Das war nicht auf Euch gemünzt – im Moment jedenfalls nicht. Nehmt aber bitte zur Kenntnis, dass ich Euch die Hand meine Tochter nicht überließe. Entschuldigt mich bitte, Graf Steinburg.“
Der adlige Tuchhändler verschwand im Gedränge seiner Gäste, ohne dem Adjutanten Tillys Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben.
Wolf war es gewöhnt, nicht gerade mit stiefelleckendem Buckeln behandelt zu werden, aber diese Arroganz schlug seiner Ansicht nach dem Fass den Boden aus. Er brauchte alle Beherrschung, um nicht vor Wut den Büfetttisch zu zerkleinern. Die gute Laune, die sich beim Gespräch mit Katharina eingestellt hatte, war dahin. Ein leises Seufzen der Resignation entrang sich dem jungen Mann. Wenn Katharina eine Rose war – und daran gab es für Wolf keinerlei Zweifel – dann war ihr Vater der dazugehörige Dornenstiel …
Kapitel 5
Eine Frage der Ehre
„Wolf, was ist mit Euch? Seit wir bei Braunsberg waren, seid Ihr nicht mit Mostrich zu genießen!“
Tillys recht knurrige Feststellung riss Wolf aus seinen immer noch zornigen Gedanken. Entgegen Tillys ursprünglicher Absicht war die Armee noch nicht nach Norden weitergezogen. Der General erwartete noch Kundschaftermeldungen, bevor er Ernst von Mansfelds derzeit herrenlose und damit umso gefährlichere Armee aufstöbern konnte.
„Es ist nichts“, knurrte Wolf zurück.
„Wolf, jetzt seid ehrlich zu Euch selbst, mein Junge: Ihr habt Euch in das Mädchen verliebt“, mutmaßte Tilly. Wolf fiel vor Schreck die Feder aus der Hand, dass sein Dienstherr den Grund seines Zornes kannte. Der alte General deutete Wolfs jetzige Reaktion allerdings falsch.
„Noch gar nicht gemerkt, wie?“, schmunzelte er. „Wolf, ich war doch auch mal jung wie Ihr. Ihr habt diesen verliebte-Kater-Blick. Seit wir bei dem Fest waren, seid Ihr kaum ansprechbar. Ihr reagiert nur noch, wenn ich Euch wirklich anstoße. Ich kenne das – so war ich als junger Spund auch. Da hilft nur die schnelle Entscheidung“, empfahl Johann von Tilly.
Wolf rieb sich müde die Augen. Er hatte seit dem Fest drei Tage zuvor nicht besonders gut geschlafen.
„An mir liegt es nicht, Johann. Graf Braunsberg hat eine vorsichtige Erkundung meinerseits mit der Gewalt von zehn Batterien Artillerie zurückgeworfen“, sagte der junge Mann. Tilly strich sich durch den weißen Kinnbart.
„Ihr seid nicht vermögend, mein Junge“, sagte er dann langsam.
„Stimmt“
„Ihr schämt Euch dessen nicht, das ehrt Euch. Aber Graf Braunsberg hält Euch deshalb für jemanden, der nur auf die Mitgift scharf ist, der seinen Reichtum abstauben will.“
Wolf wollte etwas einwenden, aber Tilly winkte ab.
„Ich weiß, dass Ihr das nicht seid, Wolf. Ich bin sogar davon überzeugt, dass Ihr Katharina ein Leben ermöglichen würdet, das sie nicht spüren ließe, wie wenig Geld Ihr habt. Aber was nützt es, wenn Adolf von Braunsberg sich in den Kopf gesetzt hat, seine Kathi nur einem vermögenden Mann zur Frau zu geben? Ehrlich, gebt es auf“, empfahl Johann.
„Johann, es wird mir furchtbar schwer fallen, die Maid zu vergessen. Sie ist nicht wie die anderen Frauen, die mir begegnet sind, nicht wie die, die hier im Lager herumschleichen und sich den Männern für Geld anbieten. Sie ist klug und redegewandt, eine Frau, mit der man stundenlang reden kann. Hätte ihr Vater uns nicht so grob getrennt, hätten wir diesen Abend in netter Plauderei verbracht.“
„Ihr wärt tatsächlich nicht weitergegangen, Wolf?“, fragte Tilly schmunzelnd. Wolf sah seinen Dienstherrn offen und gerade an.
„Ich gebe mir Mühe, trotz meines Berufes ein vornehmer Mensch zu sein. Das schließt Ritterlichkeit gegenüber Damen ein. Es käme mir nicht in den Sinn, eine Dame um einer Nacht willen zu verführen“, versetzte er.
Tilly sah den jungen Mann nachdenklich an.
„Es gibt Gerede über Euch, Wolf, ich will Euch das nicht verheimlichen. Ihr seid kein Schluckspecht – was ich im Übrigen sehr begrüße, denn mir ist ein nüchterner Adjutant lieber, als einer, der ständig volltrunken unter dem Tisch liegt. Ihr hurt nicht wie jeder andere Soldat. Ich kenne Euch, und weiß, dass Ihr es nicht macht, weil Ihr ein Ehrenmann seid. Aber es gibt Leute, die daraus falsche Schlüsse ziehen.“
Wolf sprang auf.
„General, nennt mir die Namen dieser Verleumder, damit ich sie am Tratschen hindere!“
„Wenn Ihr es mit Heinrich von Grünenfels aufnehmen wollt …?“, sagte Tilly achselzuckend. Von Grünenfels war ein wahrhaft vierschrötiger Kerl, der mit seinem Bidenhander* stets in vorderster Reihe stand. Und wo Heinrich stand, gab es Tote – allerdings in den seltensten Fällen in den eigenen Reihen. Wolf war sich im Klaren darüber, dass seine noch nicht ganz gefestigte Autorität als Offizier durch Verleumdungen böse ins Wanken geraten konnte. Schon deshalb musste er Grünenfels einen Denkzettel verpassen. Es half nichts, wenn Tilly die böswilligen Äußerungen untersagte; das hätte Wolf zusätzlich zu den schlimmen Behauptungen noch den Ruf eines Muttersöhnchens eingetragen.
„Wollt Ihr so gut sein und Herrn von Grünenfels meine Duellforderung überbringen?“, bat er den General.
„Gern, aber ich würde empfehlen, dass Ihr Eure Schulter erst richtig auskuriert, bevor Ihr Euch mit Heinrich schlagt. Es könnte ganz böse enden, wenn Ihr wegen einer nicht ausgeheilten Verletzung unterliegt.“
Der Abzug der Armee verzögerte sich weiter, und drei Wochen später war die Schussverletzung völlig ausgeheilt. General Tilly befahl Heinrich von Grünenfels zu sich. Wenig später stand Grünenfels, ein Mann wie ein Bär, in Tillys Zelt.
„Es sind schlimme Gerüchte im Umlauf, die Graf Steinburg betreffen“, eröffnete Tilly.
„Ihr sprecht von unserem warmen Muttersöhnchen, Euer Liebden?“
„Eben deshalb habe ich Euch kommen lassen. Ich bin der Sache nachgegangen und musste feststellen, dass sämtliche Gerüchte, die über Herrn von Steinburg kreisen, auf Euer Ausstreuen zurückgehen. Ich werde Euch nicht einfach verbieten, so niederträchtig zu reden …“
„Das ist gut, Euer Liebden. Ich würde nämlich weitermachen!“, lachte Grünenfels schallend.
„Schweigt, Ihr dummer Tropf!“, schalt Tilly zornig. Grünenfels schwieg erschrocken.
„Graf Steinburg fordert Genugtuung, aber er gibt Euch Gelegenheit, ihn um Entschuldigung zu bitten und öffentlich zu erklären, dass Ihr Eure Gerüchte frei erfunden habt“, erklärte Tilly. Grünenfels lachte wieder dröhnend.
„Da fällt die Wahl nicht schwer. Duell mit dem Bürschchen! Ich serviere ihn Euch in vier Teilen, Euer Liebden. Wollt Ihr Ihn schräg oder gerade geteilt?“, dröhnte Grünenfels.
„Ich würde es vorziehen, wenn er Euch Euer loses Schandmaul stopft!“, versetzte Tilly eisig. „Morgen Mittag auf dem Lagermarkt könnt Ihr zeigen, ob Ihr wie ein Ehrenmann zu fechten versteht oder ob Ihr nur den Holzfäller spielen könnt. Eure Saufkumpane werden weit genug weg sein, um Euch beide nicht zu behindern.“
„Dank Euch, Euer Liebden. Da ich der Geforderte bin, darf ich die Waffe wäh…“
„Nein, dürft Ihr nicht!“, unterbrach der General kalt. „Die Waffe bestimme ich! Rapiere und Dolche!“, entschied er dann.
„Aber ich kämpfe sonst mit dem Bidenhander“, wandte Heinrich ein.
„Das weiß ich wohl, Ihr ungeschlachter Bär!“, donnerte Tilly. „Hier geht es um ein Duell unter Ehrenmännern, falls Ihr wisst, was das ist! Rapiere und Dolche und sonst nichts, verstanden?“
„Ja, Euer Liebden!“
„Raus!“, befahl der General barsch.
Am folgenden Mittag hatte der Profos den Lagermarkt räumen lassen. Die Profoswache sperrte den Platz soweit ab, dass die Duellanten auch sicher auf sich allein gestellt waren. Der Profos prüfte die Duellwaffen und befand sie für ordnungsgemäß. Die Gegner erschienen ohne Lederkoller, nur mit Hemd, Hose und Stiefeln bekleidet. Wolf hatte die Ärmel halb aufgekrempelt. Dabei wurde an den kräftigen Unterarmen sichtbar, dass unter dem Hemd keineswegs mehr der Schwächling steckte, als der er bei Tilly einmal angefangen hatte. Auf das Zeichen des Profos nahmen die Fechter ihre Waffen und begaben sich auf den Duellplatz. Wolf wirkte ernst wie immer. Heinrich verteilte grobe Scherze über das, was er mit seinem Gegner machen wollte. Wolf schien es nicht zu hören. Heinrich tönte, den Hänfling von Gegner in spätestens drei Minuten entwaffnet und wie eine Laus zerquetscht zu haben.
„En garde!“, kommandierte der Profos. Die Duellanten kreuzten die Klingen. Mit einem zweiten Kommando gab der Profos das Gefecht frei. Schon nach dem ersten Vorgeplänkel bemerkte Grünenfels, dass der von ihm so geschmähte junge Graf ein ernst zu nehmender Gegner war und nicht nur wegen seiner schönen Handschrift oder seines guten Aussehens der Adjutant des Generals war. Der junge Mann war zäh und ausdauernd. Was der vierschrötige Riese mit Kraft bewirken wollte, neutralisierte Wolf mit Beweglichkeit. Die Klingen schwirrten sirrend durch die Luft, ab und zu versuchte einer der Fechter, einen Dolchhieb mit der linken Hand anzubringen. Dieser Linke-Hand-Dolch hatte den Schild aus der Ritterzeit ersetzt, der eine reine Defensivwaffe gewesen war. Jetzt war es möglich, auch mit der verteidigenden Hand anzugreifen. Der Linke-Hand-Dolch erforderte aber viel Beweglichkeit des Fechters – und Heinrich tapste wie ein Tanzbär durch den Ring. Wolf wich seinen wuchtig geführten Hieben geschickt aus. Plötzlich flog Heinrichs Dolch nach einem schraubenartigen Hieb seines Kontrahenten im hohen Bogen davon. Ein Profosgardist konnte gerade noch ausweichen, sonst wäre er getroffen worden. Ein anderer Profoswächter sicherte die Waffe. Wolf sprang an die Seite und drückte seinen Dolch einem Wächter mit einem:
„Haltet bitte mal!“,
in die Hand und eilte in die Mitte des Rings zurück.
Heinrich versuchte, den Degen mit beiden Händen zu führen, wie er es von seinem Bidenhander gewohnt war. Bei einer Waffe mit Griffkorb war das aber schwierig, vor allem weil Heinrich wahre Bärenpranken als Hände hatte. Die beidhändig gehaltene Waffe war zu starr, um die Klingenelastizität auszunutzen. Nach wenigen Hieben brach Heinrichs Rapier mit scharfem Misston in der Mitte durch. Wolf sah das Duell damit als beendet an. Ein Duell führte er nicht bis zum Tod, wenn es nicht sein musste.
Er grüßte den Schiedsrichter, als Heinrich ihn wie ein Panther von hinten ansprang und zu Boden riss. Wolf verlor den Degen, nach dem Heinrich sofort angelte, um dem eingeklemmten Wolf die Kehle durchzuschneiden. Doch während Heinrich noch an das Rapier zu kommen versuchte, rammte Wolf ihm beide Knie in empfindsame Teile, was auch für einen Elefanten wie Heinrich von Grünenfels zu viel war. Aufjaulend rollte er von Wolf herunter, der sein Rapier dem Profos zuschob und den überraschten Heinrich im Nahkampf anging. Grünenfels bekam eine solche Serie von Ohrfeigen, dass ihm Hören und Sehen verging. Ein wuchtiger Kinnhaken ließ von Grünenfels zu Boden gehen, Wolf setzte hinterher. Schließlich hatte Wolf ihn an der Gurgel zu fassen und drückte zu. Schon ganz blau im Gesicht wedelte Heinrich hilflos mit den Unterarmen, denn auf den Oberarmen kniete Wolf. Die Beine bekam er trotz angestrengter Versuche nicht hoch, weil sein gut mit Bier gefütterter Bauch dies verhinderte.
„Gut“, sagte Wolf keuchend. „Heinrich, ich möchte von dir hören, dass du zurücknimmst, was du Beleidigendes gesagt hast“, forderte er. Grünenfels gurgelte etwas.
„Lauter!“, befahl Wolf und lockerte den Würgegriff etwas.
„Ich nehme es zurück!“, hustete Heinrich.
„Was im Einzelnen?“
„Dass Ihr Sodomit* seid.“
„Was noch?“
„Dass Ihr ein Muttersöhnchen seid.“
„Was noch?“
„Dass Ihr gar nicht von Adel seid.“
„Hast du noch etwas in Umlauf gesetzt?“
„Ich weiß es nicht mehr genau. Aber sollte ich noch etwas Beleidigendes gesagt haben, nehme ich es hiermit zurück.“
„Du gibst dich geschlagen?“
„Ja“
„Und du wirst mich nicht mehr angreifen?“
„Nein“
„Gut“
Wolf stand auf und gab von Grünenfels frei, der noch immer ganz blau nach Atem rang. Nach Grünenfels’ Zusage, er werde ihn nicht mehr angreifen, wagte Wolf es, ihm den Rücken zuzukehren und zum Richterpult zu gehen. Als er die dort abgegebenen Waffen entgegennahm, hörte er einen Warnruf:
„Achtung, Graf: Grünenfels!“
Wolf drehte sich um und sah Grünenfels mit erhobenem Bidenhander auf sich zu stürmen. Vor Verblüffung fast starr, hob Wolf mehr im Reflex das Rapier, dem Heinrich nicht mehr ausweichen konnte; dazu war er zu nahe heran und hatte ob seines Körpergewichtes einen zu langen Bremsweg. Das Rapier durchbohrte ihn fast bis zum Heft. Mit erstauntem Blick sah Heinrich auf Wolf und die Waffe in dessen Hand und seiner Brust. Dann brach sein Blick und er stürzte tot zu Boden, das Rapier noch immer in der Brust. Alles stand wie gelähmt. Jeder, der das Duell beobachtet hatte, war Zeuge gewesen, dass Wolf das Duell bereits lange für beendet angesehen hatte und dass Grünenfels es gewesen war, der seine Niederlage nicht hatte hinnehmen wollen. Der Profos winkte auf Wolfs fragenden Blick ab.
„Es ist nicht Eure Schuld, Leutnant von Steinburg. Grünenfels hat Euch nach Beendigung des Duells angegriffen. Ihr habt Euch gewehrt, und Ihr hattet das Recht, ihn zu töten.“
Wolf nickte wortlos, zog sein Rapier aus Heinrichs Brust und ging fort. Wenn es noch jemanden gab, der an Wolf von Steinburg in irgendeiner Form gezweifelt hatte, sah er spätestens jetzt ein, dass Tilly einen besseren Adjutanten nicht haben konnte. Dennoch wollte bei Wolf keine rechte Freude über das gewonnene Duell aufkommen. Er hatte – wenn auch in Notwehr – einen guten Soldaten getötet. Heinrich von Grünenfels’ Tod würde eine große Lücke in die Vorhut reißen.
Hier endet die Leseprobe. Wenn dir diese Probe gefallen hat, findest du das ganze Buch mit 304 Seiten hier:
Wolf von Steinburg im Tredition Shop
Taschenbuchausgabe 11,00 €
Gebundenes Buch 19,00 €
E-Buch 3,99 €
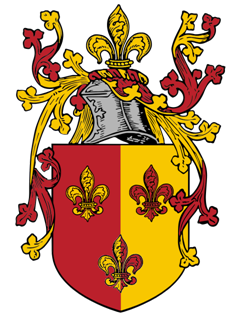
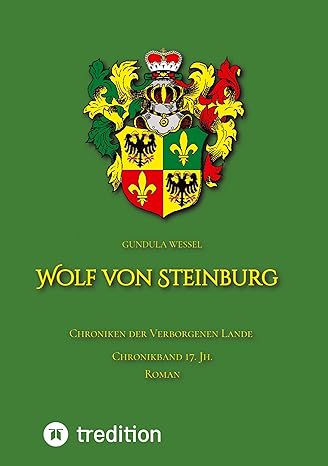
Schreibe einen Kommentar